Am 13. September 2025 veröffentlichte Stadtpfarrer Stefan Buß aus Fulda bei Osthessennews einen „Impuls“ zum kirchlichen Fest der Kreuzerhöhung.
Was als spirituelle Reflexion daherkommt, offenbart bei näherer Betrachtung eine zutiefst problematische Ideologie: die systematische Verklärung von Gewalt, Leid und Tod als göttlichen Heilsplan.
tl;dr: Hauptkritikpunkte
- Die Verklärung von Gewalt: Die Umdeutung eines Folterinstruments in ein Heilssymbol
- Irrationale Paradoxe: Die Verwendung von Widersprüchen als angebliche Wahrheit
- Normalisierung des Leidens: Die Darstellung von Schmerz als spirituell wertvoll
- Instrumentalisierung persönlicher Krisen: Religiöse Tröstungen statt praktischer Hilfe
- Historische Gewaltlegitimation: Wie die Kreuzestheologie Gewalt rechtfertigte
Die Umdeutung der Brutalität
Buß beginnt mit der richtigen Erkenntnis: Das Kreuz war ein „Folterinstrument“ und steht für „das dunkelste Kapitel menschlicher Grausamkeit“. Doch anstatt bei dieser nüchternen Feststellung zu bleiben, vollzieht er eine rhetorische Volte, die das Grauen in etwas Heiliges verwandelt. Diese Umdeutung ist nicht nur intellektuell unredlich – sie ist gefährlich.
Wenn Folter, Erniedrigung und qualvoller Tod als „Weg zum Leben“ verklärt werden, wird Gewalt theologisch legitimiert. Diese Denkweise hat jahrhundertelang dazu gedient, Leiden zu rechtfertigen, anstatt es zu bekämpfen.
Das Paradox als Denkblockade
Buß feiert das „Paradox des christlichen Glaubens“, wonach aus „dem Zeichen des Todes das Zeichen des Lebens“ wird. Doch Paradoxe sind kein Ausweis tiefer Wahrheit – sie sind oft Hinweise auf widersprüchliches oder irrationales Denken.
Die Behauptung, dass „in der tiefsten Erniedrigung schon die Erhöhung“ geschehe, mag poetisch klingen, verschleiert aber eine brutale Realität: Jesus starb qualvoll am Kreuz. Punkt. Alles andere ist nachträgliche theologische Interpretation, keine historische Tatsache.
Die Normalisierung des Leidens

Besonders problematisch wird Buß‘ Argumentation, wenn er das Kreuz als „untrennbar zu unserem Glauben“ gehörig bezeichnet – „nicht als Schmuckstück oder bloßes Symbol, sondern als Lebensweg“. Diese Aussage normalisiert Leiden als unvermeidlichen und sogar wünschenswerten Teil des menschlichen Daseins.
Aus humanistischer Sicht ist diese Haltung zutiefst schädlich. Anstatt Leiden zu bekämpfen, wo es möglich ist, wird es als spirituell wertvoll verklärt. Diese Denkweise hat historisch dazu geführt, dass Menschen unnötige Qualen ertragen haben, anstatt nach rationalen Lösungen zu suchen.
Die Instrumentalisierung persönlicher Krisen
Wenn Buß schreibt, dass „jede Not, jede Last, die wir tragen, mit Christus verbunden sein und dadurch verwandelt“ werden kann, instrumentalisiert er menschliches Leid für religiöse Zwecke. Statt konkrete Hilfe oder rationale Problemlösungsstrategien anzubieten, wird Trost durch mystische Verbindung mit einem längst verstorbenen Religionsstifter versprochen.
Diese Haltung kann Menschen davon abhalten, aktiv gegen ihre Probleme vorzugehen oder professionelle Hilfe zu suchen. Warum einen Therapeuten aufsuchen oder gesellschaftliche Missstände bekämpfen, wenn das Leiden ohnehin „verwandelt“ wird?
Die Perversion der Opferrolle
Die Aussage „Wer unter dem Kreuz steht, darf schon auf die Auferstehung hoffen“ macht aus einer Position der Schwäche eine spirituelle Tugend. Diese Rhetorik kann dazu führen, dass Menschen in schädlichen Situationen verharren, weil sie ihr Leiden als religiös wertvoll interpretieren.
Besonders problematisch ist dies im Kontext häuslicher Gewalt, Ausbeutung oder Unterdrückung, wo religiöse Leidensideologie dazu missbraucht werden kann, Opfer zum Schweigen zu bringen.
Ein rationaler Gegenentwurf
Aus humanistischer Sicht sollten wir Leiden nicht verklären, sondern bekämpfen. Statt das Kreuz als „Siegeszeichen“ zu feiern, sollten wir:
- Medizinische Forschung fördern, um Krankheiten zu heilen
- Soziale Gerechtigkeit vorantreiben, um strukturelle Gewalt abzubauen
- Bildung stärken, um Menschen zu befähigen, ihre Probleme selbst zu lösen
- Psychologische Unterstützung ausbauen, um seelisches Leid zu lindern
- Rechtssysteme verbessern, um Schutz vor Gewalt zu gewährleisten
Die Gefahr der Leidensromantik
Buß‘ Schlussformel „Wir rühmen uns des Kreuzes“ offenbart das Kernproblem christlicher Leidenstheologie: Die Verherrlichung des Unheils. Diese Haltung kann zur Lähmung führen – warum sollte man aktiv gegen Probleme vorgehen, wenn Leiden spirituell wertvoll ist?
Geschichte der Gewaltlegitimation
Historisch betrachtet hat die Kreuzestheologie unermessliches Leid legitimiert: Kreuzzüge wurden im Namen des Kreuzes geführt, Inquisition und Hexenverfolgungen mit der Nachfolge Christi begründet, koloniale Gewalt als Missionierung verklärt. Auch heute noch dient die Leidensverherrlichung dazu, strukturelle Ungerechtigkeit zu rechtfertigen.
Fazit: Leben statt Leiden
Stefan Buß‘ „Impuls“ zur Kreuzerhöhung mag für Gläubige tröstlich sein – aus rationaler Sicht propagiert er eine gefährliche Ideologie der Leidensverklärung. Statt ein antikes Folterinstrument zu „erhöhen“, sollten wir uns dafür einsetzen, dass Menschen ein würdiges Leben ohne unnötiges Leiden führen können.
Die Antwort auf menschliches Leid liegt nicht in mystischer Verwandlung, sondern in rationaler Problemanalyse, wissenschaftlicher Forschung und aktivem Engagement für eine gerechtere Welt. Wir brauchen keine theologischen Paradoxe – wir brauchen praktische Lösungen für reale Probleme.
Das wäre wahre Menschlichkeit: Leiden zu lindern, statt es zu verklären.
Text mit KI bearbeitet









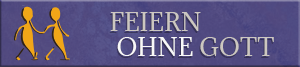
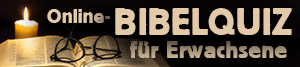
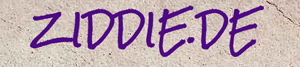


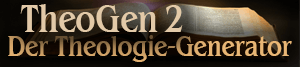

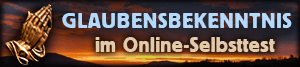
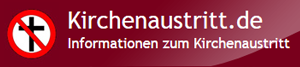
>>…instrumentalisiert er menschliches Leid für religiöse Zwecke<<
Damit ist alles gesagt!