Vergiftung der Seelen – Das Wort zum Wort zum Sonntag, verkündigt von Annette Behnken, veröffentlicht am 20.9.2025 von ARD/daserste.de
Darum geht es
Religiöse Dramatisierung als politisches Instrument – wenn das „Wort zum Sonntag“ zur politischen Kampfschrift wird: Eine Kritik zu Annette Behnkens „Vergiftung der Seelen“Am 20. September 2025 nutzte Annette Behnken ihr „Wort zum Sonntag“ für eine bemerkenswerte Predigt über gesellschaftliche „Vergiftung“.
Was sie als spirituelle Botschaft präsentiert, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als hochproblematische Vermischung religiöser Autorität mit politischer Agitation – ein Paradebeispiel dafür, wie religiöse Rhetorik zur Manipulation öffentlicher Meinung missbraucht wird.
tl;dr
- Religiöse Instrumentalisierung: Behnken nutzt ihre geistliche Autorität für politische Meinungsmache und präsentiert ihre Positionen als göttlich legitimiert.
- Dämonisierung des politischen Gegners: Die Verwendung des „Diabolos“ (Teufel) zur Charakterisierung Andersdenkender verlässt den Boden demokratischer Diskussionskultur.
- Geschichtsmissbrauch: Das Stuttgarter Schuldbekenntnis von 1945 wird schamlos instrumentalisiert, um aktuelle politische Gegner zu diskreditieren.
- Emotionale Manipulation: Die gesamte Rhetorik („Gift“, „Vergiftung“) zielt auf Angsterzeugung statt rationale Argumentation ab.
- Anti-intellektualistische Tendenz: Das „Fühlen“ wird über das Denken gestellt, rationale Analyse durch emotionale Überwältigung ersetzt.
- Pseudoneutralität: Während sie religiöse Neutralität vorgibt, betreibt sie unverhohlen politische Agitation.
Die Metaphysik des „Gifts“: Wenn Politik zur Theologie wird
Behnken beginnt ihre Predigt mit einer dramatischen Inszenierung alltäglicher Befindlichkeiten als quasi-mystische Erfahrung. „Ich fühl’s“ – dieser Refrain zieht sich durch den gesamten Text und etabliert eine subjektive, emotionale „Wahrheit“, die jeder rationalen Analyse entzogen ist. Was genau sie „fühlt“, wird nie konkret benannt, sondern bleibt in nebulösen Andeutungen verhaftet.
Die Verwendung der Giftmetapher ist besonders perfide: Sie suggeriert eine unsichtbare, aber tödliche Bedrohung, die überall lauert – in der S-Bahn, beim Kaffee, zu Hause. Diese paranoide Grundstimmung wird dann geschickt mit politischen Gegnern verknüpft, ohne dass ein kausaler Zusammenhang hergestellt würde. Es ist klassische Angstrhetorik, die durch religiöse Autorität legitimiert wird.
Teufelsaustreibung im 21. Jahrhundert
Der Höhepunkt religiöser Instrumentalisierung erreicht Behnken mit dem direkten Verweis auf den „Diabolos“ – den biblischen Teufel als „Verdreher“. Hier wird politische Opposition nicht mehr als legitimer Meinungsstreit verstanden, sondern als metaphysischer Kampf zwischen Gut und Böse gedeutet. Diese Dämonisierung des politischen Gegners ist nicht nur undemokratisch, sondern gefährlich.
Wer seine politischen Ansichten als göttlich legitimiert darstellt und Andersdenkende implizit mit dem Teufel assoziiert, verlässt den Boden demokratischer Diskussionskultur. Die Antwort „Wahrhaftigkeit und Liebe“ klingt zwar schön, wird aber ausschließlich der eigenen Position zugeschrieben – ein klassischer Mechanismus religiöser Selbstgerechtigkeit.
Geschichtsmissbrauch und moralische Erpressung
Besonders problematisch ist Behnkens Verwendung des Stuttgarter Schuldbekenntnisses von 1945. Dieses historische Dokument, entstanden aus der Erschütterung über die Rolle der Kirchen im Nationalsozialismus, wird hier schamlos instrumentalisiert, um aktuelle politische Gegner zu diskreditieren. Die implizite Gleichsetzung gegenwärtiger politischer Auseinandersetzungen mit dem Holocaust ist nicht nur geschichtsvergessen, sondern verharmlosend gegenüber den tatsächlichen Opfern des NS-Regimes.
Die Formulierung „hätten wir doch, wären wir doch“ fungiert als moralische Erpressung: Wer nicht Behnkens politische Agenda unterstützt, macht sich der historischen Verantwortungslosigkeit schuldig. Diese Instrumentalisierung der Shoah für tagespolitische Zwecke ist inakzeptabel.
Die Illusion religiöser Neutralität
Behnken präsentiert ihre Botschaft als unpolitische, rein spirituelle Mahnung. Doch bereits die Wortwahl verrät die politische Agenda: „rechtsradikaler Rassist“, „Hass und Hetze“, „jüdische Künstler:innen“ – dies sind keine theologischen, sondern politische Kategorien. Die Pfarrerin nutzt ihre religiöse Autorität, um bestimmte politische Positionen als göttlich sanktioniert darzustellen, während sie andere implizit verdammt.
Echte religiöse Neutralität würde bedeuten, allgemeine ethische Prinzipien zu verkünden, ohne konkrete politische Akteure zu bewerten. Behnken tut das Gegenteil: Sie macht das Pfarramt zum Instrument politischer Meinungsbildung.
Säkulare Demokratie vs. religiöse Bevormundung
Aus säkularer Sicht ist Behnkens Predigt ein Angriff auf die demokratische Meinungsbildung. Demokratie lebt davon, dass verschiedene Positionen gleichberechtigt debattiert werden können, ohne dass eine Seite göttliche Autorität für sich beansprucht. Wer seine politischen Überzeugungen als religiös legitimiert präsentiert, entzieht sie dem demokratischen Diskurs.
Die „radikale Hoffnung“, die Behnken beschwört, ist nichts anderes als die Hoffnung auf den Sieg der eigenen politischen Agenda. Sie wird nicht rational begründet, sondern durch göttliche Autorität abgesichert – ein vormodernes Denkmuster, das in einer aufgeklärten Gesellschaft nichts zu suchen hat.
Emotionale Manipulation statt rationaler Argumentation
Behnkens gesamte Rhetorik zielt auf emotionale Manipulation ab: „Gift“, „Vergiftung“, „Erschöpfung“, „dünnhäutig“ – diese Begriffe sollen Angst und Mitleid erzeugen, nicht zum Nachdenken anregen. Die ständige Betonung des „Fühlens“ gegenüber dem Denken ist typisch für populistische Rhetorik, die rationale Analyse durch emotionale Überwältigung ersetzen will.
Humanistische Ethik hingegen setzt auf Vernunft, offene Diskussion und die Fähigkeit des Menschen, durch Argumente überzeugt zu werden. Behnkens Anti-Intellektualismus („Am Ende steht keine Antwort, sondern eine Umarmung“) ist das Gegenteil aufgeklärten Denkens.
Die Gefahr religiöser Politisierung
Behnkens Predigt steht exemplarisch für eine gefährliche Entwicklung: die Politisierung des Religiösen und die Sakralisierung des Politischen.
Wenn Pfarrer ihre Kanzeln zu politischen Rednerpulten machen und ihre religiöse Autorität zur Durchsetzung politischer Ziele missbrauchen, wird der demokratische Diskurs beschädigt.
Fazit: Aufklärung statt Einschüchterung
Annette Behnkens „Wort zum Sonntag“ ist ein Lehrstück dafür, wie religiöse Rhetorik zur politischen Manipulation eingesetzt werden kann. Statt spiritueller Erbauung liefert sie emotionale Manipulation, statt ethischer Orientierung politische Agitation, statt göttlicher Botschaft allzu menschliche Meinungsmache.
Eine aufgeklärte, säkulare Gesellschaft braucht keine Pfarrer als politische Stichwortgeber. Sie braucht Bürger, die selbständig denken, offen diskutieren und sich durch Argumente statt durch religiöse Autorität überzeugen lassen.
Demokratie funktioniert nicht durch „radikale Hoffnung“, sondern durch rationale Meinungsbildung und den respektvollen Austausch unterschiedlicher Positionen.
Behnkens Predigt mag gut gemeint sein, aber sie schadet sowohl der Religion als auch der Demokratie: Religion verliert an Glaubwürdigkeit, wenn sie zum Instrument politischer Agitation wird. Und Demokratie leidet, wenn göttliche Autorität demokratische Diskussion ersetzen soll.
Text mit KI bearbeitet









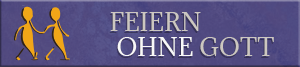
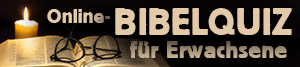
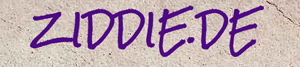


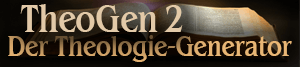

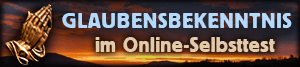
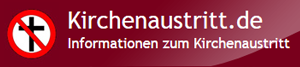
Politik und Religion haben schon immer als vermeintlich ungleiches Geschwisterpaar dem gleichen Ziel gedient: Der Unterwerfung, und Steuerung des Volkes.
Der einzige Unterschied besteht darin, das Politik nicht immer auf einem Absolutheitsanspruch beruht und Kompromisse somit durchaus möglich sind.
Teufelsaustreibung im 21. Jahrhundert
Hierzu was aktuelles aus dem Vatikan.
https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2025-09/papst-leo-xiv-botschaft-exorzisten-heikler-dienst-des-trostes.html
»Vom 15. bis 20. September 2025 fand in Sacrofano bei Rom der XV. Internationale Kongress der Internationalen Vereinigung der Exorzisten (AIE) statt, der alle zwei Jahre im Wechsel mit den nationalen Treffen ausgerichtet wird. Etwa 300 Exorzisten aus allen Kontinenten sowie ihre Helfer nahmen daran teil. Experten aus dem Vatikan und der Weltkirche informierten die Teilnehmer unter anderem über Neuerungen im Exorzismusrituale, Zusammenhänge zwischen Psychologie und Exorzismus sowie historische und dogmatische Grundlagen der Exorzismuspraxis, wie aus einem Statement der Vereinigung hervorgeht.
Mehrere Kardinäle und Bischöfe nahmen teil, darunter Kardinal Pietro Parolin, der in seiner Predigt die Demut und den Dienstcharakter des Amtes betonte.«
»Papst Leo XIV. hat seine „Wertschätzung für die Priester, die sich dem heiklen und zugleich notwendigen Dienst des Exorzisten widmen“ ausgedrückt und sie ermutigt, diesen Dienst „als Dienst der Befreiung und des Trostes“ zu leben. Das geht aus einer Botschaft Leos an eine durch die Internationale Vereinigung der Exorzisten (AIE) ausgerichtete Konferenz hervor.«
Nirgendwo ist aber die Rede davon, dass Teufel und Dämonen laut katholischer Lehre Geschöpfe Gottes sind. Man erfährt auch nicht wo die Teufel und Dämonen sich nach ihrer Austreibung rumtreiben. Ja wo laufen sie denn ? Ja wo laufen sie denn ? Nach biblischem Vorbild müssten sie ja in Schweine gescheucht werden, die sich dann in einem See ertränken. So sieht ja laut Bibel die hoffentlich nachhaltige Entsorgung der Dämonen aus.
In der Pressemitteilung ( https://katholisches.info/2025/09/23/magie-des-chaos-internationaler-exorzistenkongress/ ) finde ich jedenfalss nicht eine klare Aussgage über Anamnese, Diagnose oder Therapie einer Besessenheit. Ebensowenig finden sich klare Aussagen über die die künftige Rolle von Psychologen, Psychotherapeuten oder sonstigen Medizinern.
…und so welche wollen uns was von vergifteten Seelen erzählen.
Hut ab! Ein sehr klarer und sehr solider Kommentar – auf analytischer und normativer Ebene. Er sticht sehr positiv aus dem allgemeinen, qualitativ unterirdischen ideologischen Geblubber und Geplapper zur Ermordung Kirks heraus.
👍👍👍