Wovon lebt der Mensch? – Menschlichkeit – Das Wort zum Wort zum Sonntag, verkündigt von Benedikt Welter (kath.), veröffentlicht am 27.09.2025 von ARD/daserste.de
Darum geht es
Wenn Menschlichkeit zur göttlichen Markenware wird: Pfarrer Welter nutzt gesellschaftliche Probleme, um religiöse Lösungsansätze zu bewerben.In seinem jüngsten „Wort zum Sonntag“ unternimmt der katholische Geistliche Benedikt Welter einen bemerkenswerten argumentativen Salto: Er beginnt mit der durchaus berechtigten Beobachtung menschlicher Rohheit und Aggression in unserer Gesellschaft, um dann – wie es seine Zunft seit Jahrhunderten tut – die Lösung ausschließlich im religiösen Bereich zu verorten. Was als nachdenkliche Gesellschaftskritik beginnt, entpuppt sich als geschickte Verkaufsstrategie für ein uraltes Produkt.
tl;dr
- Vereinnahmung säkularer Kritik: Welter zitiert Brecht, einen religionskritischen Autor, um seine religiöse Botschaft zu untermauern
- Monopolisierung der Menschlichkeit: Die implizite Behauptung, nur der Glaube könne Menschen menschlich machen
- Ignorierung säkularer Ethik: Millionen ethisch handelnder Menschen ohne Glauben werden ausgeblendet
- Symptombekämpfung statt Ursachenanalyse: Strukturelle Probleme werden durch spirituelle „Lösungen“ ersetzt
Die Diagnose ist richtig, die Therapie fragwürdig
Welter hat recht: Aggression gegen Hilfspersonal, Gewalt in Krankenhäusern, die Verrohung zwischenmenschlicher Umgangsformen – das sind reale Probleme unserer Zeit. Seine Beobachtung, dass Menschen vergessen, „dass sie Menschen sind“, trifft einen wunden Punkt. Doch hier beginnt bereits die Manipulation: Indem er Brechts „Dreigroschenoper“ zitiert – ein zutiefst sozialkritisches, religionskritisches Werk – vereinnahmt er eine säkulare Analyse für seine religiöse Agenda.
Brechts Verse prangern die kapitalistischen Verhältnisse an, die Menschen zu Wölfen machen. Welter aber dreht das um: Nicht die gesellschaftlichen Strukturen sind das Problem, sondern dass die Menschen „vergessen haben, Mensch zu sein“ – als wäre Menschlichkeit eine Art spirituelles Gedächtnis, das man einfach verloren hat.
Der theologische Taschenspielertrick
Der eigentliche Kniff kommt dann: Nach der düsteren Diagnose präsentiert Welter Jesus als Lösung. Nicht etwa menschliche Solidarität, nicht Bildung, nicht bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte oder strukturelle Reformen – nein, die Antwort liegt in der Nachahmung eines Gottes, der sich zum Menschen „entäußert“ hat.
Das ist theologische Marktpsychologie in Reinform: Erst das Problem verschärfen, dann die exklusive Lösung anbieten. Dabei übersieht Welter geflissentlich, dass Menschlichkeit kein christliches Patent ist. Empathie, Mitgefühl und moralisches Handeln sind evolutionäre Errungenschaften unserer Spezies, die sich völlig unabhängig von religiösen Systemen entwickelt haben.
Wo ist die säkulare Menschlichkeit?
Besonders perfide ist Welters implizite Behauptung, nur der Glaube an Gott könne Menschen „daran erinnern“, menschlich zu sein. Das ist nicht nur historisch falsch – die schlimmsten Unmenschlichkeiten wurden oft im Namen Gottes verübt – sondern auch eine Beleidigung für Millionen Menschen, die ohne religiöse Überzeugungen ein ethisches Leben führen.
Wo sind in Welters Weltbild die säkularen Humanisten, die Menschenrechtsaktivisten ohne Glauben, die atheistischen Ärzte ohne Grenzen? Wo sind die unzähligen Menschen, die täglich Menschlichkeit beweisen, ohne sich dabei auf göttliche Vorbilder zu berufen? Sie kommen in seiner Erzählung schlicht nicht vor – als existierten sie nicht.
Die Arroganz der Stellvertretung
Welters Schlussfolgerung offenbart die ganze Arroganz der religiösen Weltanschauung: „Ich halte mich an Gottes Erinnerungsvermögen – einfach um als Mensch Mensch zu bleiben.“ Die Botschaft ist unmissverständlich: Ohne Gott kein Menschsein. Wer nicht glaubt, vergisst automatisch seine Menschlichkeit.
Das ist nicht nur logisch unhaltbar, sondern auch empirisch widerlegt. Die skandinavischen Länder, die zu den säkularsten der Welt gehören, weisen gleichzeitig die höchsten Werte bei Sozialstandards, Menschenrechten und gesellschaftlichem Zusammenhalt auf. Umgekehrt korreliert starke Religiosität oft mit Intoleranz, Diskriminierung und sozialer Ungerechtigkeit.
Echte Lösungsansätze statt Seelenheil
Statt auf göttliche „Erinnerungshilfen“ zu setzen, sollten wir die realen Ursachen menschlicher Entfremdung angehen: Überlastung im Gesundheitswesen, soziale Ungleichheit, Bildungsdefizite, Stress durch prekäre Lebensverhältnisse. Die Caritas-Beraterin braucht keine Bibelzitate, sondern bessere Sicherheitsmaßnahmen und gesellschaftliche Wertschätzung ihrer Arbeit.
Menschlichkeit entsteht nicht durch göttliche Gnade, sondern durch menschliche Anstrengung: durch Bildung, durch den Aufbau empathischer Fähigkeiten, durch gerechte Gesellschaftsstrukturen und durch die rationale Erkenntnis, dass unser aller Wohlergehen miteinander verknüpft ist.
Fazit: Menschlichkeit gehört den Menschen
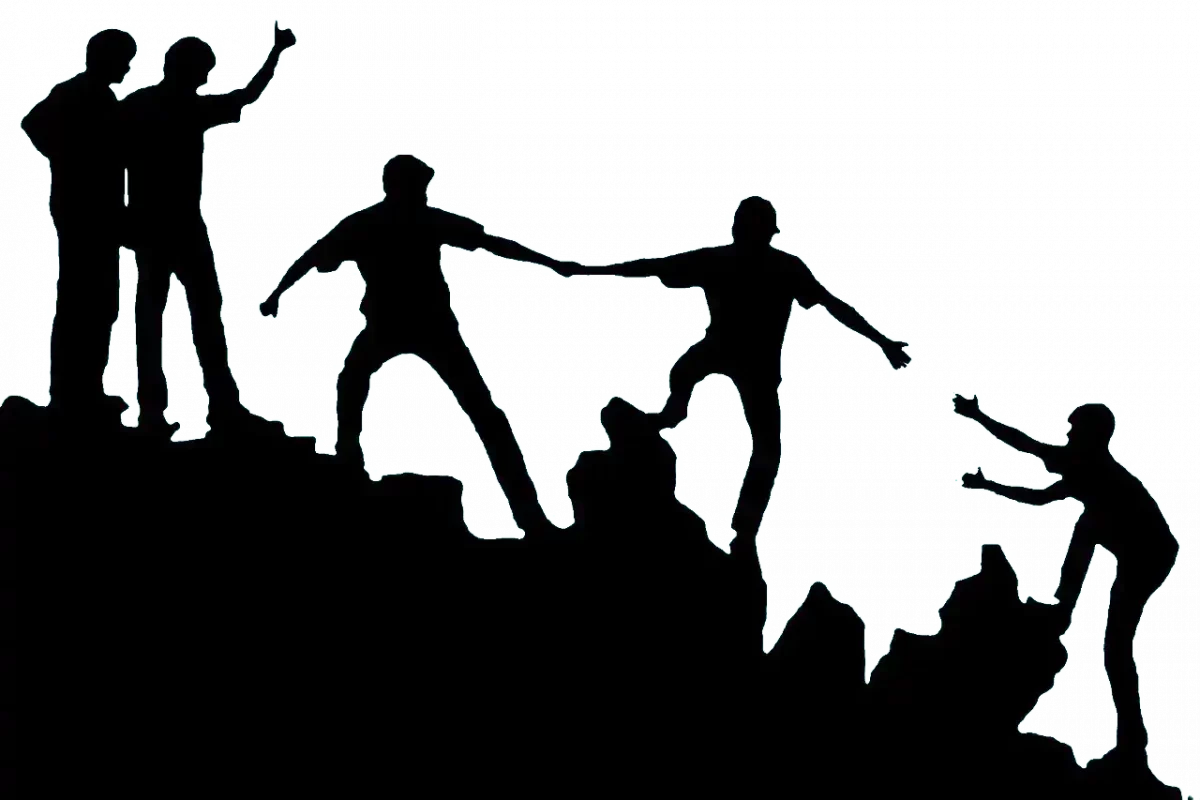
Welters „Wort zum Sonntag“ ist symptomatisch für die Art, wie religiöse Institutionen versuchen, grundmenschliche Werte zu monopolisieren. Menschlichkeit ist aber kein Markenzeichen des Christentums, sondern das gemeinsame Erbe aller Menschen – gläubige wie ungläubige.
Die 50 Worte Menschlichkeit, die Welter aus der Bibel „ausleihen“ will, gehören nicht Paulus oder Jesus. Sie gehören uns allen – als Menschen, die fähig sind zu Mitgefühl, Solidarität und ethischem Handeln, ganz ohne himmlische Anleitung.
In diesem Sinne: Einen menschlichen – also einen rationalen und selbstbestimmten – Sonntag.
Text mit KI bearbeitet









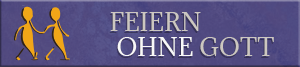
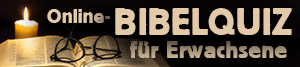
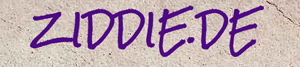


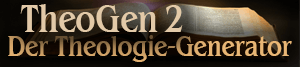

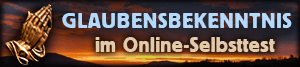
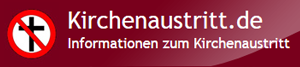
Wie im Artikel schon betont, ignoriert Herr Welter hartnäckig die Tatsache, dass es ungläubige und nichtreligiöse Menschen gibt, die ein menschliches Leben führen, manche sicher „tugendhafter“ als viele Christen.
Warum tut er das – wie übrigens viele seiner Zunft?
Ich sag`s Euch:
Weil er es nicht ertragen kann, dass Menschen ohne Gott gut sein können.
Denn das aktuelle unterschwellig, früher offen dominierende Fundament und Selbstverständnis, der Dreh- und Angelpunkt seines Glaubens ist nicht das gebetsmühlenartig propagierte Liebesgesülze, sondern die Sünde, insbesondere die Erbsünde, die Schuldhaftigkeit, die göttliche Vergebung und Erlösung und die göttliche Bestrafung und Verdammung.
Ohne diese perfiden, sado-masochistischen Kopfgeburten wäre die christliche Religion nur ein zahnloser Tiger.
Das gilt allerdings auch in ähnlicher Form für andere Religionen. Da hat das Christentum kein Monopol drauf.
Im Übrigen muss immer wieder erwähnt werden, dass der Vatikan das einzig staatliche Gebilde auf der Welt ist, das die UN-Charta der Menschenrechte nicht unterschrieben hat.