Gedanken zu: Impuls von Stefan Buß: Der Evangelist Lukas, veröffentlicht am 19.10.2025 von osthessennews.de
Darum geht es
Der Fuldaer Stadtpfarrer Stefan Buß widmet seinen jüngsten Impuls dem Evangelisten Lukas – und liefert damit unfreiwillig ein Lehrstück darüber, wie moderne Kirchen Geschichte, Legende und fromme Wunschvorstellungen zu einem unkritischen Narrativ vermischen.Lukas: Legende statt Fakten
Buß‘ Text beginnt bereits mit einer Ungenauigkeit: Die Zuschreibung des Lukasevangeliums an einen historischen Arzt namens Lukas aus Antiochia ist keineswegs gesichert. Die neutestamentliche Forschung geht heute mehrheitlich davon aus, dass die Evangelien anonym verfasst wurden und die Namen der Evangelisten erst im 2. Jahrhundert hinzugefügt wurden.
Der Pfarrer präsentiert jedoch fromme Überlieferungen als historische Tatsachen – ein klassisches Beispiel für die Vermischung von Glaubenserzählung und Geschichte.
Besonders problematisch: Buß erwähnt zwar beiläufig, dass das Lukasevangelium „um 90 n. Chr.“ datiert wird, verschweigt aber die Konsequenzen. Wenn Jesus etwa 30 n. Chr. starb, liegt zwischen den Ereignissen und ihrer Niederschrift eine 60-jährige Lücke. Von „Augen- und Ohrenzeugen“ zu sprechen, ist bei dieser Zeitspanne historisch fragwürdig.
Es wäre, als würde heute jemand über die 1960er Jahre berichten und behaupten, direkt mit Zeitzeugen gesprochen zu haben – technisch möglich, aber kaum glaubwürdig für detaillierte Berichte. Erst recht im 1. Jahrhundert, wo das durchschnittliche Höchstalter bei etwa 25 Jahren (Quelle) bzw. bei etwa 40 Jahren (ohne Berücksichtigung der hohen Kindersterblichkeit) lag.
Die Gottessohn-Legende: Nichts Neues unter der Sonne
Was Buß ebenfalls verschweigt: Die „Kindheitsgeschichte Jesu“, die Lukas so detailliert schildert, folgt narrativen Mustern, die in der antiken Mittelmeerwelt längst etabliert waren. Die Vorstellung einer göttlichen Geburt, eines Gottessohnes, der von einer Jungfrau geboren wird und Wunder vollbringt, war zur Zeit der Evangelienentstehung keineswegs originell.
Horus, der ägyptische Gott, wurde angeblich von der Jungfrau Isis empfangen, in einer bescheidenen Unterkunft geboren und von Hirten besucht. Mithras, dessen Kult zur Zeit der frühen Christen im Römischen Reich weit verbreitet war, wurde am 25. Dezember geboren und als „Licht der Welt“ verehrt. Dionysos wurde vom Göttervater Zeus gezeugt und sollte die Menschheit erlösen. Krishna im Hinduismus wurde von der Jungfrau Devaki geboren, der tyrannische König Kamsa versuchte, ihn als Kind zu töten – eine verblüffende Parallele zur Herodes-Geschichte bei Matthäus.
Auch Herkules, Perseus, Romulus und Augustus galten als göttlich gezeugt. Augustus, der erste römische Kaiser, wurde bereits zu Lebzeiten als „Sohn Gottes“ (divi filius) verehrt – Jahrzehnte bevor die christlichen Evangelien geschrieben wurden. Die Inschrift „Kaiser Augustus, göttlicher Sohn, Erlöser und Friedensbringer“ findet sich auf antiken Münzen und Tempeln.
Die religionsgeschichtliche Forschung zeigt deutlich: Die Erzählmuster der Evangelien – wunderbare Geburt, göttliche Abstammung, Heilungen, Totenerweckungen, Tod und Auferstehung – sind typische Elemente hellenistischer Mythologie. Lukas und die anderen Evangelisten schrieben nicht in einem kulturellen Vakuum, sondern in einer Welt, die von solchen Geschichten durchdrungen war.
Das wirft eine entscheidende Frage auf: Warum sollte ausgerechnet die christliche Version dieser Erzählungen historisch wahr sein, während alle anderen als Mythen gelten? Die Kirche beansprucht für ihre Gottessohn-Geschichte Einzigartigkeit und historische Wahrheit – dabei verwendet sie dieselben narrativen Bausteine wie die „heidnischen“ Kulte, die sie später als Aberglauben verdammte.
Reliquienkult und magisches Denken
Der Text schwelgt geradezu in mittelalterlicher Frömmigkeit: Reliquien, die nach Konstantinopel kommen, Legenden über Marienbilder, Schutzheilige für verschiedene Berufsgruppen. Was hier als selbstverständlicher Teil der christlichen Tradition präsentiert wird, ist aus rationaler Sicht nichts anderes als magisches Denken.
Die Verehrung von Knochenresten (Reliquien), die angeblich einem Menschen gehörten, der vor fast 2000 Jahren starb, dessen Existenz nicht einmal zweifelsfrei belegt ist – solche Praktiken unterscheiden sich strukturell kaum von animistischen Kulten. Dass eine moderne Institution wie die katholische Kirche im Jahr 2025 solche Vorstellungen noch propagiert, ist erstaunlich.
Die „Kindheitsgeschichte“ – oder: fromme Fiktion
Buß hebt hervor, dass Lukas uns „hauptsächlich die Kindheitsgeschichte Jesu“ überliefert. Was er nicht erwähnt: Diese Geburtserzählungen bei Lukas und Matthäus widersprechen sich fundamental. Matthäus kennt keine Volkszählung, keinen Stall, keine Hirten. Lukas kennt keine Weisen aus dem Morgenland, keinen Kindermord in Bethlehem, keine Flucht nach Ägypten.
Historiker sind sich weitgehend einig: Diese Geschichten wurden konstruiert, um Jesus nachträglich einen davidischen Stammbaum und eine Geburt in Bethlehem anzudichten – beides messianische Anforderungen aus den jüdischen Schriften. Die „Kindheitsgeschichte“, die „zu jedem Weihnachtsfest gehört“, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit theologische Fiktion, keine Geschichte.
Soziale Gerechtigkeit – nur im Jenseits?
Positiv erwähnt Buß, dass Lukas „gerechte soziale Beziehungen“ und die „Beachtung der Verachteten und Ausgestoßenen“ wichtig waren.
Tatsächlich enthält das Lukasevangelium einige sozial progressive Elemente. Doch bei ehrlicher Betrachtung muss man fragen: Hat das Christentum in den vergangenen 2000 Jahren tatsächlich Armut, Ungerechtigkeit und Ausgrenzung beseitigt?
Die Kirche selbst war jahrhundertelang eine der mächtigsten und reichsten Institutionen Europas – während sie den Armen Almosen gab und Trost im Jenseits versprach. Das Lukasevangelium mag schöne Worte über die Armen enthalten, aber es hat kein funktionierendes Sozialmodell geschaffen. Das haben säkulare Demokratien mit ihren Sozialstaaten getan.
Das Problem mit der Mission
Buß lobt, dass Lukas sein Evangelium „für Andersgläubige“ schrieb und Jesus als „Erlöser der Juden und Nichtjuden“ darstellte. Aus kirchlicher Sicht ist das eine positive Botschaft der Universalität. Aus kritischer Perspektive ist es der Beginn des christlichen Imperialismus.
Die Vorstellung, dass alle Menschen – ob sie wollen oder nicht – eines „Erlösers“ bedürfen und nur durch Jesus Christus gerettet werden können, ist zutiefst übergriffig. Sie hat zu Jahrhunderten der Zwangsmissionierung, Kulturvernichtung und religiösem Kolonialismus geführt. Die „frohe Botschaft“ war für unzählige indigene Völker eine Katastrophe.
Fazit: Kritisches Denken statt frommer Impulse
Stadtpfarrer Buß‘ „Impuls“ zeigt exemplarisch, wie die Kirche im 21. Jahrhundert arbeitet: historisch unkritisch, traditionsverliebt, abgeschottet von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Statt sich mit den Widersprüchen in den Evangelien, den historischen Fragen zur Entstehung des Christentums oder der problematischen Geschichte der Kirche auseinanderzusetzen, werden Legenden kolportiert und Heilige verehrt.
In einer aufgeklärten Gesellschaft sollten wir von religiösen Führungsfiguren mehr erwarten als Märchenerzählungen. Wer im Jahr 2025 über „Reliquien“, „Schutzheilige“ und angebliche Marienbilder aus der Hand des Lukas spricht, ohne auch nur die historische Problematik anzudeuten, nimmt seine Zuhörer nicht ernst.
Die Beschäftigung mit historischen Texten – auch mit den Evangelien – erfordert kritisches Denken, nicht unkritische Verehrung. Irgendjemand, wer auch immer es gewesen sein mag, hat vor knapp 2000 Jahren unter dem Pseudonym „Lukas“ einen Text geschrieben. Mehr wissen wir nicht mit Sicherheit. Den Rest sollten wir als das behandeln, was es ist: fromme Legende, nicht historische Wahrheit.









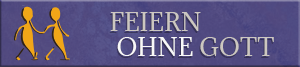
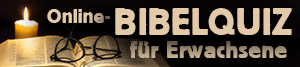
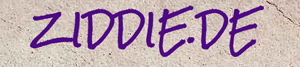


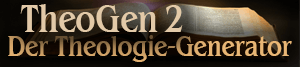

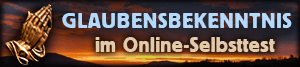
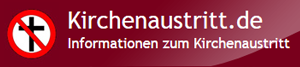
Was soll eigentlich der ständige Quatsch mit der Blutlinie Davids?!
Wenn Immanuel, äh „big J“ natürlich, aus dieser stammen sollte, dann wäre er ein ganz normaler Mensch, ein Abkömmling Davids und nicht der Sohn eines Gottes!
Das macht nur für die Juden Sinn, die damit bis heute ihre zionistischen Gebietsansprüche zu rechtfertigen suchen.
Der grosse Haken an der Sache:
Die Juden erkennen Jesus nicht als Gottessohn/Gott himself an.
Und die Christen, denen fallen die ganzen Widersprüche sowieso nicht auf, die machen sich die Welt wie sie ihnen gefällt… ( Jesus-Immanuel Langstrumpf, die Pipi von Nazareth aus Bethlehem)
Es ist echt zum verzweifeln!