Eine kritische Betrachtung religiöser Vertröstungsrhetorik: Psalm 84 – „Der Pilgerweg des Herzens“, verkündigt von Stadtpfarrer Stefan Buß, veröffentlicht am 15.11.25 von osthessen-news.de
Darum geht es
Religiöse Leidumdeutung statt echter Hilfe: Wie Psalm-Poesie menschliche Autonomie durch übernatürliche Vertröstung ersetzt.Der Fuldaer Stadtpfarrer Stefan Buß lädt uns in seinem jüngsten „Impuls“ zu einem „Pilgerweg des Herzens“ ein. Was auf den ersten Blick wie eine poetische Meditation über Psalm 84 erscheint, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als ein Paradebeispiel religiöser Bewältigungsstrategien, die mehr verschleiern als erhellen.
Die Sehnsucht nach dem Tempel – oder: Nostalgie als Programm
Der Psalm beginnt mit der Sehnsucht nach den „Wohnungen des Herrn Zebaoth“ – dem Tempel in Jerusalem. Buß interpretiert dies als zeitlose Sehnsucht nach „Frieden, Geborgenheit und Gegenwart Gottes“. Doch vergessen wir nicht: Psalm 84 ist ein historisches Dokument, entstanden in einer Zeit, als der Jerusalemer Tempel das politische und religiöse Machtzentrum eines Volkes darstellte. Die „Sehnsucht“ war keine abstrakte spirituelle Emotion, sondern konkrete Pilgerpraxis in einem theokratischen System.
Die Romantisierung dieser antiken Tempelsehnsucht als universelle menschliche Erfahrung übersieht geflissentlich die problematischen Aspekte: Tempelkult bedeutete Opferritual, Priesterhierarchie, religiöse Abgrenzung und nicht zuletzt auch wirtschaftliche Abhängigkeit.
Das dürre Tal und die magische Transformation
Besonders aufschlussreich wird Buß‘ Interpretation beim „dürren Tal“. Hier begegnen wir der klassischen religiösen Leidumdeutung: Menschen, die „ihr Herz auf Gott ausgerichtet haben“, verwandeln das Tal der Trockenheit „in einen Quellgrund“.
Diese Rhetorik ist so alt wie problematisch. Sie suggeriert:
Erstens: Leid ist transformierbar – nicht durch eigenes Handeln, nicht durch gesellschaftliche Veränderung, nicht durch medizinische oder psychologische Hilfe, sondern durch die richtige innere Haltung zu einer übernatürlichen Entität.
Zweitens: Wer im Leid keine „Quellen“ findet, hat sein Herz offenbar nicht richtig ausgerichtet. Die Verantwortung für die Bewältigung von Krisen wird individualisiert und spiritualisiert – eine klassische Victim-Blaming-Strategie im religiösen Gewand.
Drittens: Die Zusicherung, dass „Gott im Tal gegenwärtig ist“, ist eine nicht überprüfbare Behauptung, die spätestens nach Abgleich mit der irdischen Realität weder Trost spendet noch praktische Hilfe bietet. Sie ist letztlich eine Vertröstung: Das Tal verschwindet nicht (das räumt Buß selbst ein), aber irgendwie soll die Gottespräsenz es erträglicher machen.
Von Kraft zu Kraft – die Illusion der Selbstermächtigung
Buß betont, der Glaube mache uns nicht unverwundbar, gebe aber „Kraft, die nicht aus uns selbst kommt“. Hier zeigt sich das paradoxe Menschenbild der Religion: Der Mensch ist zu schwach, um aus eigener Kraft zu bestehen, benötigt aber gleichzeitig den Glauben, um Kraft zu empfangen.
Aus humanistischer Perspektive ist das eine unnötige und letztlich entmündigende Umwegkonstruktion. Menschen besitzen Resilienz, Anpassungsfähigkeit und die Fähigkeit zu Solidarität – nicht weil eine göttliche Instanz sie damit versorgt, sondern weil dies Teil unserer evolutionären und kulturellen Ausstattung ist. Die Zuschreibung dieser Kräfte an Gott entwertet die eigentliche menschliche Leistung.
Das Ziel: Begegnung mit dem Unsichtbaren
Am Ende, so Buß, erscheint jeder „vor Gott in Zion“. Das Ziel des Pilgerwegs ist die Gottesbeziehung. Doch was bedeutet eine „Begegnung“ mit einer Entität, für deren Existenz es keinerlei empirische Belege gibt?
Der Pfarrer räumt selbst ein, dass heute kaum noch jemand nach Jerusalem pilgert, „um Gott zu finden“. Der Pilgerweg sei vielmehr eine innere Bewegung – im Gebet, im Vergeben, im Festhalten an Hoffnung. Doch all diese Praktiken – Meditation, Reflexion, ethisches Handeln – funktionieren auch völlig ohne den Umweg über eine Gotteshypothese. Buddhisten, säkulare Humanisten und Atheisten praktizieren sie seit Jahrhunderten, ohne auf übernatürliche Verheißungen angewiesen zu sein.
Sehnsucht ja – aber wonach?
Buß hat recht: Jeder Mensch ist unterwegs, und viele wissen nicht wohin. Die Frage nach Sinn, Orientierung und Erfüllung ist zutiefst menschlich. Doch die Antwort muss nicht in einer 2.500 Jahre alten Tempelsehnsucht gesucht werden.
Säkularer Humanismus bietet eine Alternative: Sinn entsteht nicht durch Unterwerfung unter eine göttliche Ordnung, sondern durch selbstbestimmte Werte, durch Mitgefühl mit anderen Lebewesen, durch den Beitrag zu einer gerechteren Welt. Das „dürre Tal“ wird nicht durch religiöse Umdeutung zum Quellgrund, sondern durch konkrete Hilfe, durch Gemeinschaft, durch psychologische Unterstützung und durch den Mut, Leid als Teil des Lebens anzunehmen – ohne es verklären zu müssen.
Fazit: Poesie ohne Wahrheitsanspruch
Stefan Buß‘ Meditation ist zweifellos poetisch formuliert. Als literarische Betrachtung antiker Texte mag sie ihren Wert haben. Problematisch wird sie dort, wo sie konkrete Lebenshilfe verspricht, die sie nicht einlösen kann, und wo sie menschliche Autonomie durch religiöse Abhängigkeit ersetzt.
Der wahre Pilgerweg führt nicht zu einem unsichtbaren Gott, sondern zu uns selbst – zu unserer Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, Leid anzuerkennen ohne es zu verklären, und Sinn zu schaffen ohne übernatürliche Krücken.
Wer Quellen im dürren Tal sucht, sollte vielleicht einfach einen Brunnen graben – statt auf Regen vom Himmel zu warten.









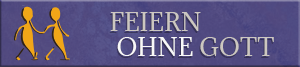
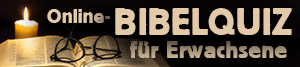
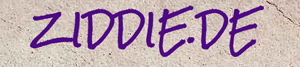


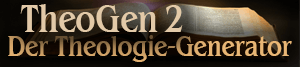

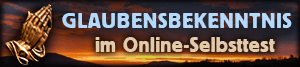
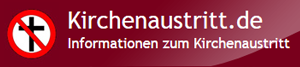
„Und wenn ich auch wandle im finstern Tal, so brauche ich doch keine Taschenlampe, denn mein religiös verstrahltes Hirn leuchtet heller durch meine Schädeldecke als das Rektum eines Glühwürmchens, das ne Duracell verschluckt hat…“
Kann mir mal bitte jemand die offizielle Anrede des „Allmächtigen“ sagen?
Mittlerweile stehen zur Auswahl:
Adonei, El, Ich bin, Jhweh, brennender Dornbusch, Jesus, Immanuel, Donald Trump, Jehova, Zebaoth u.v.m.
Wie heist der Kerl jetzt tatsächlich?