Wir gehören zusammen – Das Wort zum Wort zum Sonntag, verkündigt von Pfarrer Wolfgang Beck, veröffentlicht am 15.11.2025 von ARD/daserste.de
Darum geht es
Die Kirchen können nicht glaubwürdig Antisemitismus bekämpfen, wenn sie einerseits die Bibel als göttliche Wahrheit verkünden, andererseits aber deren antisemitische Passagen nachträglich als menschliche Irrtümer relativieren – diese theologische Bigotterie zeigt, dass wirksamer Schutz vor religiösem Hass nur durch säkulare, rationale Werte statt durch heilige Schriften möglich ist.Die selektive Geschichtsvergessenheit der Kirchen im Kampf gegen Antisemitismus
Das „Wort zum Sonntag“ vom 15. November 2025 verdient eine nüchterne Betrachtung – nicht wegen seiner unzweifelhaft wichtigen Botschaft gegen den gegenwärtigen Antisemitismus, sondern wegen der bemerkenswerten theologischen Verrenkungen, die Wolfgang Beck vollführen muss, um das Christentum von seiner antisemitischen Geschichte zu distanzieren.
Das Problem mit der „Wahrheit“
Beck verweist auf das Dokument „Nostra aetate“ von 1965, mit dem die katholische Kirche angeblich einen „Schlusspunkt“ hinter den christlichen Antijudaismus setzen wollte. Hier offenbart sich eine fundamentale Diskrepanz im christlichen Selbstverständnis: Einerseits wird die Bibel als geoffenbarte, göttliche Wahrheit verkündet – unveränderlich, ewig gültig, Fundament des Glaubens. Andererseits räumt Beck freimütig ein, dass „bis hinein in biblische Texte“ das Problem des Antijudaismus zu identifizieren ist.
Diese Relativierung wirft unbequeme Fragen auf: Wenn antisemitische Passagen im Johannesevangelium lediglich historische Irrtümer eines zeitlich und kulturell weit entfernten Autors sind – warum sollten dann andere biblische Aussagen zeitlose Wahrheiten sein? Nach welchem Kriterium wird entschieden, welche Bibelstellen wörtlich zu nehmen sind und welche als „Produkt ihrer Zeit“ gelten?
Theologische Schadensbegrenzung mit 1900 Jahren Verspätung
Beck versucht, das Johannesevangelium zu entschuldigen: Der Autor habe die verschiedenen jüdischen Gruppen zur Zeit Jesu nicht mehr differenzieren können, deshalb seien pauschale Texte über „die Juden“ entstanden. Diese nachträgliche Historisierung ist bemerkenswert: Fast zwei Jahrtausende lang galt genau dieser Text als inspiriertes Wort Gottes. Generationen von Christen lasen diese Passagen als göttlich autorisierte Wahrheit über „die Juden“ – mit verheerenden Folgen.
Nun, da diese Passagen moralisch unhaltbar geworden sind, werden sie plötzlich zu menschlichen Irrtümern erklärt. Das ist theologisch inkonsistent, aber politisch opportun. Es stellt sich die Frage: Ist die Bibel nun Gottes Wort oder ein Sammelsurium historischer Dokumente mit allen menschlichen Fehlern und Vorurteilen? Die Kirchen wollen beides gleichzeitig – je nachdem, was gerade passt.
Wenn aus „Gottesmord“ plötzlich ein Missverständnis wird
Jahrhundertelang predigte die Kirche die Deizid-Anklage: „Die Juden“ hätten Christus getötet. Diese Vorstellung durchzog Theologie, Liturgie und Volksglauben. Sie legitimierte Pogrome, Vertreibungen und systematische Diskriminierung. „Nostra aetate“ hat diese Lehre 1965 offiziell verworfen – aber kann eine Institution, die fast 2000 Jahre lang eine solche „Wahrheit“ verkündete, glaubwürdig behaupten, nun die eigentliche Wahrheit zu kennen?
Die katholische Kirche möchte für ihre Rolle in dieser Geschichte Anerkennung erhalten, weil sie 1965 – zwei Jahrzehnte nach dem Holocaust – endlich korrigierte, was sie selbst jahrhundertelang propagiert hatte. Das ist, als würde ein Brandstifter Lob dafür erwarten, dass er nach Tagen das Feuer löscht.
Wenn christliche Argumente Antisemitismus befeuern
Beck beklagt zu Recht den gegenwärtigen Antisemitismus. Doch er verschweigt, dass auch heute noch Politiker und Kirchenfunktionäre religiöse Argumente für antisemitische Positionen nutzen:
Beispiel 1: Die „Ersatztheologie“ in evangelikalen Kreisen Zahlreiche evangelikale Gruppen vertreten weiterhin die Auffassung, die Kirche habe Israel als „auserwähltes Volk“ ersetzt. Diese Theologie schwingt mit, wenn etwa Politiker in den USA oder Europa das moderne Israel durch eine christlich-theologische Brille betrachten und dessen Politik entweder bedingungslos unterstützen (christlicher Zionismus) oder delegitimieren (Ersatztheologie).
Beispiel 2: Antisemitismus im Gewand der „Israelkritik“ Kirchliche Würdenträger und christlich geprägte Politiker nutzen häufig eine Rhetorik, die zwischen legitimer Kritik an israelischer Politik und antisemitischen Stereotypen verschwimmt. Wenn etwa vom „jüdischen Staat“ als besonders aggressiv oder machtbesessen die Rede ist, knüpft dies nahtlos an alte christliche Stereotype vom „rachsüchtigen Gott des Alten Testaments“ an.
Beispiel 3: Traditionelle Karfreitagsliturgie Bis 1959 betete die katholische Kirche am Karfreitag offiziell für die „perfidis Judaeis“ (treulosen Juden). Obwohl die explizite Formulierung geändert wurde, existiert in traditionalistischen katholischen Kreisen (etwa bei der Piusbruderschaft) weiterhin eine Liturgie, die Juden als Konversionsziel benennt und ihre religiöse Tradition implizit abwertet.
Beispiel 4: Muslimisch-christliche Allianzen gegen Israel In manchen Kontexten verbünden sich christliche Funktionäre mit muslimischen Gruppen in einer „Israelkritik“, die antisemitische Verschwörungstheorien bedient – oft unter dem Deckmantel des Einsatzes für palästinensische Rechte. Die theologische Grundierung bleibt dabei christlich: das Bild vom „verstockten“ Judentum, das die „Wahrheit“ nicht erkennen will.
Die Bigotterie des Gedenkens
Beck kritisiert die „ritualisierte“ Form des Gedenkens, bei der niemand mehr „richtig hinhört“. Dieser Kritik ist zuzustimmen – doch sie trifft auch die Kirchen selbst. Das kirchliche Gedenken an die Shoah ist oft von derselben Ritualität geprägt: Man beklagt historisches Versagen, betont die eigene Läuterung und kehrt dann zur Tagesordnung über.
Echter Antijudaismus-Kritik würde bedeuten, die theologischen Grundlagen des christlichen Judenhasses offenzulegen und konsequent zu entfernen. Das hieße: die problematischen Bibelstellen zu kennzeichnen, in Gottesdiensten zu kontextualisieren oder nicht mehr zu verwenden. Das hieße, offen zuzugeben, dass die christliche Theologie über Jahrhunderte fundamental irrte. Das hieße, die Bibel nicht mehr als unfehlbares Wort Gottes, sondern als menschliches, fehlerhaftes Dokument zu behandeln.
Der humanistische Ausweg
Aus säkularer Perspektive ist die Lösung klar: Religiöse Texte – ob Bibel, Koran oder Torah – sind historische Dokumente, geschrieben von Menschen in spezifischen historischen Kontexten, durchzogen von den Vorurteilen und Irrtümern ihrer Zeit. Sie können Weisheit enthalten, aber auch Intoleranz und Hass.
Der Kampf gegen Antisemitismus kann nicht auf der Grundlage heiliger Schriften geführt werden, die selbst Teil des Problems sind. Er muss auf universellen humanistischen Prinzipien basieren: der Würde jedes Menschen, unabhängig von Religion oder Herkunft. Diese Prinzipien brauchen keine göttliche Autorisierung – sie ergeben sich aus unserem rationalen Verständnis eines gelingenden Zusammenlebens.
Solange Religionsgemeinschaften am Wahrheitsanspruch ihrer Schriften festhalten und gleichzeitig deren problematische Passagen relativieren wollen, bewegen sie sich in einem logischen Widerspruch. Ehrlicher wäre es einzugestehen: Diese Texte sind menschlich, fehlbar und müssen an modernen ethischen Standards gemessen werden – nicht umgekehrt.
Fazit
Wolfgang Becks Anliegen – gegen den gegenwärtigen Antisemitismus anzukämpfen – ist ohne Zweifel ehrenwert und notwendig. Doch sein Versuch, dies im Rahmen christlicher Theologie zu tun, führt in unlösbare Widersprüche. Die Kirchen können nicht gleichzeitig Hüter ewiger Wahrheit und selbstkritische Revisionisten ihrer eigenen Geschichte sein.
Der wirksamste Schutz gegen religiös motivierten Hass liegt nicht in der nachträglichen Umdeutung heiliger Texte, sondern in einer säkularen Gesellschaft, die ihre Werte nicht aus antiken Schriften, sondern aus aufgeklärten, rationalen Prinzipien ableitet. Menschenrechte gelten nicht, weil sie in heiligen Büchern stehen – sondern weil sie vernünftig sind.
Wer wirklich gegen Antisemitismus kämpfen will, sollte aufhören, sich auf Texte zu berufen, die diesen selbst jahrhundertelang legitimiert haben.









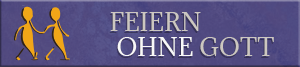
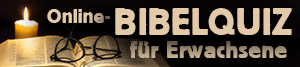
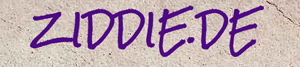


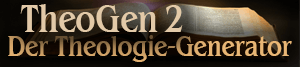

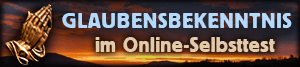
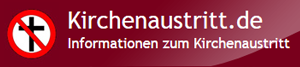
Allein der Mythos, die Juden hätten Jesus ermordet ist total behämmert…
Es war doch der Plan des christlichen Gottes von Anfang an, in seiner volkommenen Allwissenheit, seinem Sohn bzw. sich selbst ein zünftiges Sado-Maso-Wochenenderlebnis zu gönnen.
Da hat trotz Allmacht gar kein Weg vorbei geführt.
Somit waren die Juden, Judas, die Römer und alle anderen Beteiligten ein fester Bestandteil des götlichen Plans und konnten gar nicht anders handeln!
Oder liegt es vielleicht daran, dass die Juden den Schwachsinn der Christen-Sekte bis heute nicht glauben und immer noch auf die Rückkehr ihres Messias warten, der endlich die Römer aus dem heiligen Land treibt?!
Sekunde mal, bis auf ein paar italienische Touristen gibts ja gar keine römische Besatzungsmacht mehr im „heiligen Land“.
Könnte es womöglich sein, dass sowohl die Christen als auch die Juden komplett falsch liegen???
Nein, das darf nicht sein! Die Bibel ist das einzig wahre, und unverfälschte Wort Gottes!!!
Jesus kommt wieder, jeden Augenblick kann es geschehen, dass der Kerl vom Zigaretten holen zurück kommt… 2000 years later… still waiting… for nothing… 😉
Apropos „Deizid“, hier noch ein netter Songtext von DEICIDE – BLAME IT ON GOD:
„God is the reason we live in dismay
It is his will that this world’s suffering
If we do not believe what you foretell
We can expect afterlife will be hell
You are the one who killed his own son
We are the ones you’re blaming it on
Lust was created beginning with hymn
When we indulge we are guilty of sin
Torture our lives with confusion and lies
Mass contradiction, religious facades
Blame it on god
Blame it on god
Blame it on god, liar
Lord of salvation keep looking away
It is your will that this world goes astray
Take us each day from this place you unworthed
Unfulfilled promise of heaven on earth
You are the one who killed your own son
We are the ones your hatred is on
Children are dying and this you’re content
Where is your profit in what you have left
No intervention from angels above
God is the reason that satan lives on.“
Es gehört zur deutschen Staatsräson, alles, was mit Judentum im weitestens Sinne zu tun hat, als sakrosankt zu erklären. Dieser Staatsräson unterwirft sich auch Herr Beck. Daher ist er nicht willens oder fähig, zwischen jüdischer Religion, jüdischer Ethnie und jüdischer Staatlichkeit zu unterscheiden.
Er wirft alles in einen Topf. Daher erwähnt er weder den von der UNO festgestellten Genozid an den Palästinensern, noch den berechtigten Protest dagegen.
Es ist alles Antisemitismus, die allseits bekannte Todschlagskeule.
Und um das mal klarzustellen: Der Antisemitismus, wie Nazis und Neonazis ihn propagiert haben und noch propagieren, hat seine Wurzeln zwar im religionsbestimmten Antijudaismus, aber er unterscheidet nicht mehr zwischen gläubigen oder ungläubigen Juden, sondern nur noch zwischen Juden und Nichtjuden.
Die berechtigte Israelkritik hat nichts mit Antisemitismus zu tun.
Es sind das fanatische fundamentalistische Judentum, welches in Israel momentan das Sagen hat, in Kumpanei mit dem us-amerikanischen Christentum auf der einen Seite und der fanatische Islamismus auf der anderen Seite, die die permanente Krise im Nahen Osten bestimmen.
Und wenn das Terrorisieren, Morden und Aushungern der Zivilbevölkerung in Gaza und im Westjordanland aufhören und es eine friedliche Zwei-Staaten-Lösung ohne Netanjahu, Konsorten und Hamas etc. jemals geben sollte, dann würde die Wut auf Israel auch aufhören, und der wirkliche Antisemitismus, den es bedauerlicherweise natürlich gibt, in Deutschland nur noch auf kleiner Flamme übrigbleiben.
Alles andere ist am Thema vorbei, Herr Beck.
Und wenn Sie in der Aufarbeitung des christlichen Judenhasses konsequent und ehrlich wären, würden Sie Ihre Bibel wegschmeissen.