Die Asche der Toten: Das Wort zum Wort zum Sonntag, verkündigt von Anke Prumbaum, veröffentlicht am 4.10.25 von ARD/daserste.de
Darum geht es
Frau Prumbaum präsentiert diesmal einen als einfühlsame Seelsorge getarnten Versuch, religiöse Deutungshoheit über zutiefst persönliche Entscheidungen zu behaupten.Die Asche der Toten: Wenn religiöse Bevormundung als Seelsorge getarnt wird
Das aktuelle „Wort zum Sonntag“ von Anke Prumbaum widmet sich der Bestattungskultur und den neuen Möglichkeiten in Rheinland-Pfalz. Was zunächst als einfühlsame Reflexion über Trauer daherkommt, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als subtile Mischung aus paternalistischer Bevormundung und religiöser Deutungshoheit über zutiefst persönliche Entscheidungen.
tl;dr: Hauptkritikpunkte
- Religiöse Gewissheiten als Fakten
- Paternalistische Bevormundung
- Überflüssige religiöse Deutung
- Faktenfehler
- Anmaßung von Deutungshoheit
Die Anmaßung der Gewissheit
Bemerkenswert ist die Selbstverständlichkeit, mit der Prumbaum verkündet: „Ich als Christin glaube daran, dass wir uns über das Wohl dessen, der gestorben ist, keine Gedanken machen müssen. Er, sie ist bei Gott aufgehoben.“ Diese Aussage enthält gleich mehrere problematische Ebenen:
Erstens wird hier eine rein religiöse Überzeugung als beruhigende Gewissheit präsentiert, ohne auch nur anzuerkennen, dass dies lediglich ein Glaube ist – eine unbelegte Behauptung ohne empirische Grundlage. Für die Mehrheit der Menschen in Deutschland, die nicht mehr religiös sind, ist diese Aussage bestenfalls irrelevant, schlimmstenfalls übergriffig.
Zweitens offenbart sich hier das klassische Muster religiöser Weltanschauung: Unbeantwortbare Fragen werden durch dogmatische Behauptungen „gelöst“, statt die Ungewissheit des Todes ehrlich anzuerkennen.
Aus säkularer Sicht gibt es keinen Grund anzunehmen, dass nach dem Tod irgendetwas von der Person übrig bleibt, das „aufgehoben“ werden könnte.
Richtig erkannt – falsch interpretiert
Durchaus zutreffend ist Prumbaus Beobachtung, dass für Trauernde der Ort der Bestattung wichtig ist. Hier zeigt sich ihre praktische Erfahrung als Seelsorgerin. Doch warum dieser Umweg über religiöse Deutungsmuster? Die psychologische und soziale Bedeutung von Ritualen und Orten für die Trauerverarbeitung lässt sich vollständig ohne metaphysische Annahmen erklären und verstehen.
Menschen brauchen konkrete Orte und Rituale, weil sie soziale Wesen sind, weil Trauer ein komplexer psychologischer Prozess ist, und weil Erinnerung sich an Konkretes heftet.
Dafür braucht es keinen Gott und keine Seele – nur ein Verständnis der menschlichen Psyche.
Die fragwürdige Ratgeberin
Besonders problematisch wird es, wenn Prumbaum zur Ratgeberin in Sachen „richtiger“ Bestattung wird. Ihre Warnung vor der „Urne im Wohnzimmerschrank“ stützt sie auf eine Anekdote einer älteren Dame. Daraus leitet sie eine generelle Regel ab: Es sei „nicht gut“, die Urne zu Hause aufzubewahren, weil man „loslassen“ müsse.
Hier offenbart sich paternalistisches Denken in Reinform. Wer gibt Frau Prumbaum das Recht, anderen Menschen vorzuschreiben, wie sie mit ihren Toten umgehen sollen? Sicherlich mag es Menschen geben, denen eine räumliche Distanz bei der Trauerverarbeitung hilft. Aber ebenso gibt es Menschen, die Trost in der Nähe zur Asche eines geliebten Menschen finden. Die Vielfalt menschlicher Trauerprozesse lässt sich nicht in ein einheitliches Muster pressen.
Die Psychologie zeigt, dass es keine „richtige“ Art zu trauern gibt. Was dem einen Menschen schadet, kann einem anderen helfen. Die Anmaßung, hier als religiöse Autoritätsperson eine allgemeingültige Regel verkünden zu können, ist wissenschaftlich nicht haltbar und ethisch fragwürdig.
Das falsche „Memento mori“
Zum Abschluss bemüht Prumbaum das lateinische „Memento mori“ und behauptet, es stehe „schon in der Bibel“. Tatsächlich findet sich diese exakte Formulierung nirgends in der Bibel – ein kleines, aber aufschlussreiches Detail über den lockeren Umgang mit Fakten, wenn es der religiösen Argumentation dient.
Der Gedanke an die eigene Sterblichkeit kann durchaus zu Weisheit führen – aber nicht im religiösen, sondern im humanistischen Sinne: Weil unser Leben endlich ist, gewinnt es an Bedeutung. Weil es kein Jenseits gibt, in dem alles besser wird, müssen wir im Hier und Jetzt gut und gerecht leben. Weil wir nur dieses eine Leben haben, sollten wir es nicht mit der Erfüllung religiöser Vorschriften verschwenden.
Fazit zu „Die Asche der Toten“: Fortschritt trotz religiöser Bedenkenträger
Die Liberalisierung des Bestattungsrechts in Rheinland-Pfalz ist ein Fortschritt – ein Fortschritt, der gegen den Widerstand religiöser Institutionen erkämpft werden musste, die jahrhundertelang ihre Deutungshoheit über Leben und Tod verteidigten.
Dass nun Menschen selbstbestimmter entscheiden können, wie mit ihrer sterblichen Hülle umgegangen wird, ist ein Sieg der Aufklärung.
Prumbaus Beitrag zeigt exemplarisch, wie Religion auch heute noch versucht, sich als unverzichtbare moralische Instanz zu inszenieren – selbst in Bereichen, in denen sie nichts Substanzielles beizutragen hat. Empathie, psychologisches Verständnis und Respekt vor individuellen Entscheidungen brauchen keine göttliche Legitimation. Sie sind zutiefst menschlich – und funktionieren ohne Gott mindestens genauso gut, wenn nicht besser.
Text mit KI bearbeitet









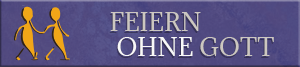
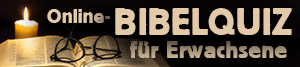
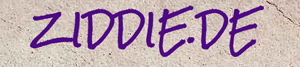


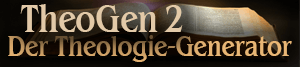

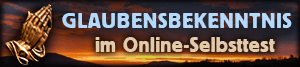
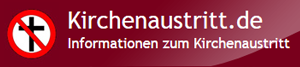
Mir ist schon oft aufgefallen, dass selbst Profi-Religiöse nicht wissen, was in der Bibel steht. Meine Vermutung: Viele von denen haben die Bibel nie als Ganzes gelesen oder gar bewusst und kritisch durchgearbeitet.
Ich glaube nicht, dass Frau Prumbaum in Bezug auf „Memento mori“ bewusst schwindelt. Sie weiß es halt einfach nicht besser, hat es irgendwo von irgendwem einmal gehört und haut es bei Gelegenheit einfach raus – „intellektuelle Redlichkeit und Sorgfalt“ bedeutet für Berufsreligiöse ja auch etwas anderes als für uns.
Frau Prumbaum sollte sich z.B. die Bücher von Kubitza oder Jörn Dyck unter den demnächst anstehenden Christbaum (bei mir im Supermarkt ist schon Weihnachten!) legen lassen: Lesen bildet!
Gerade weil es sich um eine Berufsgläubige handelt, sehe ich hier schon einen Vorsatz. Denn als Theologin weiß sie es sicher besser. Andererseits wird sie als Theologin auch in der Lage sein, sich irgendeine beliebige Bibelstelle scheinbar passend zurechtzubiegen. Kritische Rückfragen braucht sie im „Wort zum Sonntag“ ja nicht zu fürchten – das erklärt vielleicht die Ignoranz gegenüber der Wahrheit und Sinnhaftigkeit dessen, was diese Fernsehprediger von sich geben, wenn der Samstagabend lang ist.
Der Vollständigkeit halber hier noch zur Ergänzung:
Der Ausdruck memento mori stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „Bedenke, dass du sterben wirst“. Ursprünglich geht er auf einen Brauch im antiken Rom zurück: Während eines Triumphzuges wurde ein siegreicher Feldherr von einem Sklaven begleitet, der ihn mit diesen Worten daran erinnerte, dass auch Ruhm und Macht vergänglich sind und selbst der Mächtigste sterblich bleibt.
Im Mittelalter (!) wurde memento mori von der christlichen Kirche und in Klöstern wieder aufgegriffen. Es diente als Mahnung, sich auf das Wesentliche im Leben – besonders im Hinblick auf das Leben nach dem Tod – zu konzentrieren und die eigene Sterblichkeit niemals zu vergessen.
Frau Prumbaum könnte sich mit Verweis auf Psalm 90,12 herausreden:
„Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.“
Aber erstens ist das nicht deckungsgleich mit dem allgemein bekannten „memento mori“, das aus der römischen Antike stammt, worauf Marc ja schon hinweist; und zweitens vergisst sie auch noch, dass dieser von der katholischen Kirche vereinnahmte und oft als Epitaph verwendete Spruch fast immer im Zusammenhang nicht nur mit der Vergänglichkeit menschlichen Lebens gebraucht wurde, sondern auch mit dem drohenden Endzeitgericht.
Aber das passt nun mal nicht zu ihrer unbekümmerten Friede-Freude-Eierkuchen-Interpretation des christlichen Glaubensgedöns. Das würde die noch halbwegs glaubenden Zuhörer doch nur verschrecken und die Nichtglaubenden weiter abstossen.
Hm, also ich kann mich an mehrere Diskussionen – auch an der Uni – mit Theologen erinnern, bei denen ich Nachhilfe zum Thema „Inhalt der Bibel“ geben musste. Vor allem bei Geschichten und „Schlagwortthemen“ wie Hiob oder der Bergpredigt habe ich den Eindruck, dass Theologen zwar viel darüber und dazu gelesen haben – aber die Originale nur oberflächlich kennen. Das Original geht oft in der Flut an „Interpretationen“ unter.
Das macht auch Sinn: Im „Studium“ lernen sie ja auch schwerpunktmäßig alle möglichen Tricks zur Uminterpretation, Umdeutung, dem Ignorieren und Verdrängen von Tatsachen.
Aber, natürlich: Bevor man wie beim WzS vor eine durch unser aller Gebühren bezahlte Kamera tritt, sollte ein Quellen-Check selbstverständlich sein.
Also bei mir steht neben nem dekorativen Ziegenschädel tatsächlich ne Urne im Regal. In den Deckel hab ich nen kleinen Schlitz gemacht und somit diente uns der „zweckentfremdete Aschenbecher“ damals in der WG als Partykasse.
Memento mori… für einen bewussten Rausch und Spass am Leben, wohlwissend, dass alles was wir konsumieren sich auch negativ auswirken kann. 😉
P.S.: Der „Aschenbecher“ ist fabrikneu übernommen worden und ich musste keinen vorherigen Bewohner davon zwangsräumen!
Nicht dass mir noch irgendein Gestörter, die Störung von definitiv nicht mehr störbaren Gestörten vorwirft… 🙂
Hier eine interessante Adresse zum Thema: urne-zuhause.de
Korrektur: Die Adresse lautet: urne-zuhaus.de Entschuldigung.