Stadtpfarrer Stefan Buß aus Fulda serviert uns in seinem jüngsten Impuls auf osthessennews.de eine rührende Anekdote aus dem 19. Jahrhundert:
Ein Bauer sitzt täglich stumm in der Kirche und erklärt dem neugierigen Pfarrer von Ars, er schaue den lieben Gott an, und der liebe Gott schaue ihn an.
Buß findet das „sehr schön“ und erkennt darin eine „tiefe Wahrheit“ über das stille Gebet.
Aus humanistischer und rationaler Perspektive offenbart diese Geschichte jedoch vor allem eines: die psychologischen Mechanismen religiöser Selbsttäuschung.
Die Projektion als spirituelle Praxis
Was der Bauer – und mit ihm Pfarrer Buß – als göttliche Begegnung beschreibt, ist aus psychologischer Sicht ein klassischer Fall von Projektion. Der Gläubige sitzt in einem für religiöse Zwecke konditionierten Raum, versetzt sich in einen meditativen Zustand und interpretiert seine eigenen mentalen Prozesse als Interaktion mit einer übernatürlichen Entität. Der „liebevolle Blick Gottes“ ist nichts anderes als die eigene Sehnsucht nach Zuwendung und Akzeptanz, projiziert auf eine imaginierte Instanz.
Die Formulierung „ich schaue den lieben Gott an, und der liebe Gott schaut mich an“ klingt poetisch, beschreibt aber letztlich einen einseitigen Vorgang: Ein Mensch sitzt mit geschlossenen oder offenen Augen da und stellt sich vor, dass jemand zurückschaut. Dass diese Vorstellung beruhigend oder tröstlich wirken kann, bestreitet niemand – aber das macht sie nicht wahr.
Stille als Tugend – oder als Denkverbot?
Buß betont, dass Gebet „nicht nur Reden“ sei, sondern „Sein vor Gott“. Das klingt zunächst wie eine willkommene Abkehr vom Gebetsgeschwätz, das sich in endlosen Bittlitaneien erschöpft. Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich: Die propagierte Stille ist keine kritische, fragende Stille, sondern eine kontemplativer Unterwerfung.
Es geht nicht darum, innezuhalten und zu reflektieren, sondern darum, die eigene Gedankentätigkeit zugunsten einer passiven „Gegenwart Gottes“ auszusetzen. Aus rationaler Sicht ist das problematisch: Statt den Verstand zu nutzen, um über die eigene Situation, ethische Fragen oder die Beschaffenheit der Wirklichkeit nachzudenken, wird empfohlen, sich in einen Zustand unkritischer Rezeptivität zu versetzen.
Der imaginäre Freund für Erwachsene
Besonders aufschlussreich ist Buß‘ Vergleich: „So wie Freunde schweigend beieinandersitzen können, weil sie sich verstehen, so darf auch der Mensch vor Gott still werden.“ Dieser Vergleich hinkt gewaltig. Freunde sitzen tatsächlich beieinander – sie sind physisch präsent, ihre Existenz ist verifizierbar, ihre Beziehung beruht auf realer Interaktion.
Die „Freundschaft mit Gott“ hingegen ist eine einseitige Angelegenheit: Der Gläubige redet, schweigt, bittet und dankt – und interpretiert seine eigenen Gefühle, Gedanken und zufälligen Lebensereignisse als Antworten.
Das ist nicht Freundschaft, sondern parasoziale Beziehung zu einer fiktiven Figur. Kinder haben imaginäre Freunde; die meisten wachsen irgendwann daraus heraus. Die Religion institutionalisiert diese Praxis für Erwachsene.
Die narzisstische Kränkung der Einsamkeit
Was der Impuls verschweigt: Die Sehnsucht nach diesem „liebevollen Blick“ entspringt oft existenzieller Einsamkeit und dem Bedürfnis nach bedingungsloser Akzeptanz. Statt sich dieser Bedürfnisse bewusst zu werden und reale menschliche Beziehungen zu pflegen, bietet die Religion eine Ersatzbefriedigung an: den allmächtigen Zuhörer, der immer verfügbar ist, nie widerspricht und dessen „Liebe“ man sich nicht durch mühsame Beziehungsarbeit verdienen muss.
Aus humanistischer Sicht ist das eine verpasste Chance. Statt Menschen zu ermutigen, ihre Einsamkeit anzuerkennen und aktiv Gemeinschaft mit anderen Menschen zu suchen, wird eine Scheinnähe zu einer nicht existenten Entität kultiviert. Das mag kurzfristig tröstlich sein, löst aber keine realen Probleme und fördert eine Weltflucht statt Weltgestaltung.
Man braucht nicht viel Phantasie, um sich vorstellen zu können, dass ein zölibatär lebender katholischer Priester „in den besten Jahren“ ein besonderes Bedürfnis haben dürfte, die eigene Einsamkeit durch eine eingebildete Beziehung zu einem imaginären Götterwesen zu kompensieren. Immerhin kommen bei dieser Form der Ersatzbefriedigung keine anderen Menschen zu Schaden.
Meditation ohne Metaphysik
Interessanterweise ist an der Praxis selbst – dem stillen Dasitzen, dem Zur-Ruhe-Kommen, dem Abschalten des inneren Monologs – nichts Falsches. Im Gegenteil: Meditation und Achtsamkeitspraxis haben nachweisbare positive Effekte auf das psychische Wohlbefinden. Aber dafür braucht es keine göttliche Kulisse, keine Kirche und keine theologische Überhöhung.
Man kann still sein, ohne sich einzureden, dass einen dabei jemand anschaut. Man kann meditieren, ohne metaphysische Behauptungen aufzustellen. Man kann zur Ruhe kommen, ohne die Vernunft am Kirchenportal abzugeben. Säkulare Achtsamkeitspraxis bietet all das – ohne die intellektuelle Unredlichkeit, eigene mentale Prozesse als göttliche Begegnungen umzudeuten.
Fazit: Stille ja, Selbsttäuschung nein
Pfarrer Buß‘ Impuls ist ein Paradebeispiel dafür, wie Religion psychologische Bedürfnisse aufgreift und mit unbelegten metaphysischen Behauptungen anreichert. Die Sehnsucht nach Ruhe, Akzeptanz und Geborgenheit ist zutiefst menschlich – aber sie rechtfertigt nicht die Behauptung, dass ein unsichtbares Wesen uns liebevoll anschaut.
Aus humanistischer Sicht sollten wir Menschen ermutigen, ihre Bedürfnisse ehrlich anzuerkennen, reale Beziehungen zu pflegen und Stille als das zu praktizieren, was sie ist: eine wertvolle Praxis der Selbstwahrnehmung – nicht der Gotteswahrnehmung.
Weniger Projektion, mehr Reflexion. Weniger himmlische Blicke, mehr irdische Begegnungen. Das wäre ein Impuls, der der Würde des Menschen gerecht wird.
Text mit KI bearbeitet










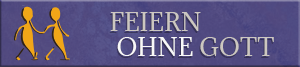
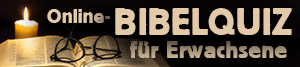
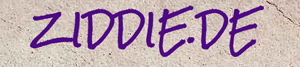


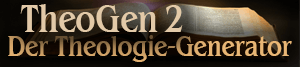

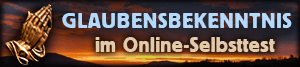
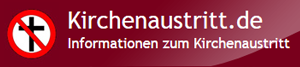
Ich sitz auch jeden Sonntag in der Ruine des stillgelegten Kinos und geniesse es, wie John Wayne mich liebevoll von der leeren Leinwand aus anlächelt…NICHT!
Aber wusste nicht schon der alte Friedrich Nietzsche zu sagen:
„Wenn du lange genug in den Fernseher starrst und das Wort zum Sonntag guckst, dann schaut der Pfarrer irgendwann in dich zurück“ …oder so ähnlich… 😉