Eine kritische Auseinandersetzung mit Stadtpfarrer Stefan Buß‘ unkritischer Psalmen-Verklärung
Darum geht es
Für seine Darstellung der biblischen Psalmen als zeitloses Gebetbuch voller Trost, Ehrlichkeit und spiritueller Tiefe verleihen wir Stadtpfarrer Stefan Buß aus Fulda die Goldene Rosine am Band.Stadtpfarrer Stefan Buß aus Fulda preist in seinem jüngsten „Impuls“ die Psalmen als zeitloses Gebetbuch voller Trost, Ehrlichkeit und spiritueller Tiefe. Was er dabei geflissentlich verschweigt: Diese antiken Texte enthalten ein erschreckendes Maß an Gewaltverherrlichung, Rachefantasien und moralisch inakzeptablen Vorstellungen, die in keiner aufgeklärten Gesellschaft des 21. Jahrhunderts noch als „Gebetsschatz“ durchgehen sollten.
Die systematische Ausblendung des Problematischen
Buß schwärmt von der „ganzen Bandbreite menschlicher Erfahrungen“ in den Psalmen und führt harmlose Beispiele wie Lobpreis, Dankbarkeit und Vertrauen an. Was er nicht erwähnt: Diese Texte enthalten auch brutale Gewaltaufrufe und ethisch untragbare Passagen, die man Kindern auf keinen Fall vorlesen würde – es sei denn, sie stehen zufällig in einem als „heilig“ deklarierten Buch.
Werfen wir einen Blick auf eine exemplarische Auswahl der laut Buß „lebendigen Gebete, die Gott uns schenkt, damit wir ihn anrufen können“ und die der Stadtpfarrer elegant unter den Teppich kehrt:
Psalm 137,9: „Wohl dem, der deine Kinder packt und am Felsen zerschmettert!“
Lies das noch einmal. Hier wird Kindermord nicht nur beschrieben, sondern explizit als wünschenswert gepriesen. „Wohl dem“ – also gesegnet, glücklich zu preisen ist, wer Säuglinge an Felsen zerschmettert. Diese Passage steht in einem Text, den Buß als „Schule des Gebets“ empfiehlt, die uns lehrt, „wie wir mit Gott sprechen können“.
Psalm 109,9-10: „Seine Kinder sollen Waisen werden und seine Frau eine Witwe. Seine Kinder sollen umherirren und betteln.“
Ein „Gebet“, das den Tod eines Gegners und das Elend seiner unschuldigen Familie herbeisehnt. Ist das die „Ehrfurcht“ und „Freiheit“, von der Buß spricht?
Psalm 58,7-11: „Gott, zerbrich ihnen die Zähne im Maul […] Der Gerechte wird sich freuen, wenn er solche Vergeltung sieht, und wird seine Füße baden im Blut der Frevler.“
Sadistische Rachefantasien, die sich an der Vorstellung ergötzen, die Füße im Blut der Feinde zu baden. Soll das tatsächlich „Worte finden helfen, wenn dem Menschen selbst die Sprache fehlt“?
Psalm 69,23-29: „Lass ihre Augen finster werden, dass sie nicht sehen […] Gieß deinen Grimm über sie aus […] Tilge sie aus dem Buch des Lebens.“
Verfluchungen und Vernichtungswünsche, die an Erbarmungslosigkeit kaum zu überbieten sind.
Die intellektuelle Unredlichkeit der selektiven Darstellung
Buß‘ Methode ist typisch für apologetische Religionsverkündigung: Man pickt sich die einigermaßen akzeptablen Rosinen heraus („Der HERR ist mein Hirte“), verschweigt systematisch alles Problematische und präsentiert das Ganze als zeitlose Weisheit. Das ist intellektuell unredlich.
Würde jemand ein antikes Werk vorstellen und dabei konsequent alle rassistischen, sexistischen oder gewaltverherrlichenden Passagen verschweigen – wir würden diese Person zu Recht der Geschichtsfälschung bezichtigen. Bei religiösen Texten wird diese selektive Blindheit jedoch als „Glaubensverkündigung“ durchgewinkt.
Das Problem mit der „Ehrlichkeit“
Besonders perfide ist Buß‘ Argument, die Psalmen seien „ehrlich“ und würden „nichts verschweigen“. Ja, sie verschweigen nichts – auch nicht die dunkelsten menschlichen Impulse. Aber ehrlich zu sein bedeutet nicht automatisch, gut oder nachahmenswert zu sein. Ein Gewaltverbrecher, der offen über seine Mordgedanken spricht, ist auch „ehrlich“ – das macht seine Gedanken nicht zu einem wertvollen spirituellen Vorbild.
Die Frage ist nicht, ob die Psalmen ehrlich sind, sondern ob sie moralisch vertretbar sind. Und hier liegt das Problem: Indem diese Texte als „Gebete“ deklariert werden, wird die in ihnen enthaltene Gewalt sakralisiert, wird Rache religiös legitimiert, werden Vernichtungswünsche zu einem Gespräch mit Gott stilisiert.
Die gefährliche Normalisierung von Gewalt
Wenn ein Stadtpfarrer im Jahr 2025 Texte empfiehlt, die Kindermord gutheißen und sich am Blutvergießen ergötzen, ohne auch nur ein kritisches Wort zu verlieren, dann ist das mehr als nur ein intellektuelles Versäumnis – es ist eine Normalisierung von Gewalt unter dem Deckmantel der Spiritualität.
Niemand würde heute ein Buch empfehlen mit dem Hinweis: „Hier finden Sie wunderbare Gedichte über die Liebe – und nebenbei auch ein paar Anleitungen zum Kindermord, aber lassen Sie sich davon nicht stören!“ Bei religiösen Texten wird genau das aber erwartet: kritiklose Übernahme, fromme Verklärung, intellektuelle Kapitulation vor der Tradition.
Was wäre eine ehrliche Auseinandersetzung?
Eine redliche Behandlung der Psalmen würde anerkennen, dass diese Texte Produkte ihrer Zeit sind – einer Zeit, in der Stammesdenken, Vergeltung und religiös legitimierte Gewalt zur Normalität gehörten. Man könnte sie als historische Dokumente studieren, als Zeugnisse einer vergangenen Mentalität, vielleicht sogar einzelne Passagen als poetischen Ausdruck menschlicher Emotionen würdigen.
Was man nicht tun sollte: Sie unkritisch als zeitlose spirituelle Anleitung anpreisen, sie in Gottesdiensten rezitieren lassen und sie als „Schule des Gebets“ für das 21. Jahrhundert empfehlen.
Die humanistische Alternative
Humanismus bedeutet, moralische Maßstäbe anzulegen, die nicht von der vermeintlichen Heiligkeit eines Textes abhängen, sondern von seinem tatsächlichen Gehalt. Ein Satz, der Kindermord gutheißt, bleibt moralisch verwerflich – egal ob er in einem modernen Buch oder in einem antiken „heiligen“ Text steht.
Wir brauchen keine 3000 Jahre alten Rachepsalmen, um mit unseren Emotionen umzugehen. Die moderne Psychologie bietet uns weitaus bessere Werkzeuge, um Wut, Trauer und Angst zu verarbeiten – ohne dabei in Gewaltfantasien abzugleiten. Wir können Trost und Gemeinschaft finden, ohne Texte zu rezitieren, die unsere Feinde verfluchen und ihre Kinder dem Verderben wünschen.
Fazit: Kritik ist kein Sakrileg
Stadtpfarrer Buß‘ unkritische Psalmen-Verklärung ist symptomatisch für einen Umgang mit religiösen Texten, der im 21. Jahrhundert nicht mehr akzeptabel sein sollte. Wer behauptet, diese Texte seien in ihrer Gesamtheit „lebendig“, „tröstlich“ und als Gebetsanleitung geeignet, verschließt die Augen vor ihrem gewaltverherrlichenden Gehalt – oder billigt ihn stillschweigend.
Es ist höchste Zeit für eine ehrliche, kritische Auseinandersetzung mit diesen antiken Texten. Nicht um sie zu „canceln“, sondern um sie in ihren historischen Kontext einzuordnen und klar zu benennen, was in ihnen nicht zeitlos, sondern zeitgebunden und ethisch überholt ist.
Religion verdient keine Sonderbehandlung im rationalen Diskurs. Und Texte, die Kindermord segnen, verdienen keine fromme Verklärung – egal, wie alt sie sind.
Übrigens: Jesus mag die Psalmen gebetet haben – aber er hat auch einen Feigenbaum verflucht, Dämonen in Schweine verhext und sie sich selbst ertränken lassen, die Endzeit für seine Generation angekündigt (die bekanntlich nicht eintrat) und gedroht, Ungläubige würden von seinem Gott „wie Unkraut ausgerissen“ und in den Feuerofen geworfen, wo sie „heulen und mit den Zähnen knirschen“.
Es ist also keineswegs so, dass sich an der biblischen Aussage durch das Neue Testament irgendwas verbessert hätte. Im Gegenteil: Durch die Einführung des Höllenkonzeptes wurde die Unmenschlichkeit und Brutalität dieses Glaubenskonstruktes nochmal auf ein neues Level gebracht.
Goldene Rosine am Band für Stadtpfarrer Stefan Buß aus Fulda
Für seine völlig einseitige, unkritische und verharmlosende Darstellung der biblischen Psalmen als zeitloses Gebetbuch voller Trost, Ehrlichkeit und spiritueller Tiefe verleihen wir Stadtpfarrer Stefan Buß aus Fulda heute die Goldene Rosine am Band.
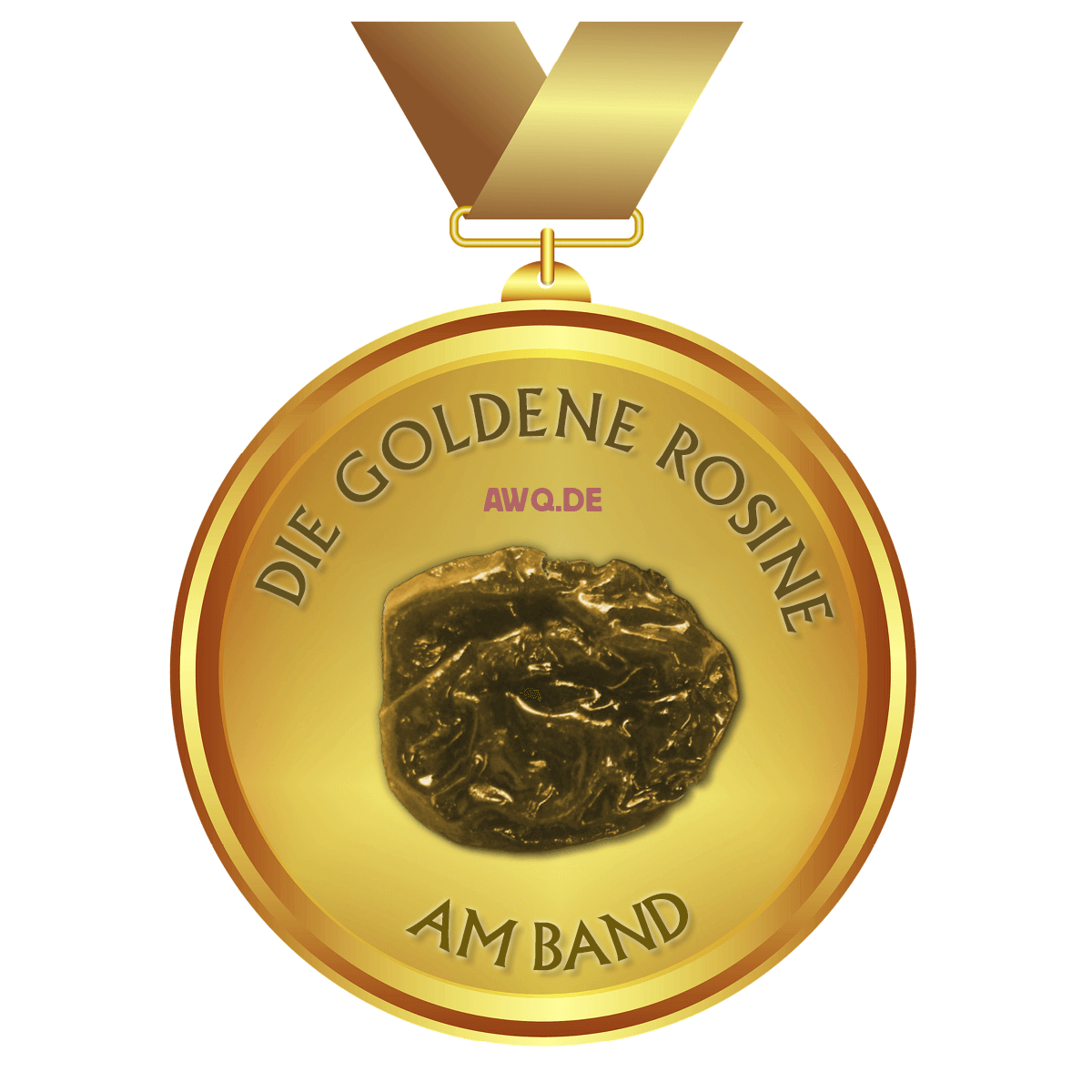
Nachtrag
An dieser Stelle frage ich mich einmal mehr, was Beiträge wie die von Herrn Buß eigentlich auf einem Online-Newsportal mit journalistischem Anspruch zu suchen haben.
Journalistische Werte lassen sich vor allem durch ethische Grundprinzipien, die Berufsethik und Kriterien zur Auswahl und Darstellung von Nachrichten beschreiben. Für journalistische Tätigkeit gelten gewisse Werte wie zum Beispiel:
- Wahrhaftigkeit: Die Achtung vor der Wahrheit, die wahrhaftige Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Wahrung der Menschenwürde. Diese Werte sind im deutschen Pressekodex verankert und gelten als oberste Gebote der Presse.
- Glaubwürdigkeit: Sie wird vor allem durch wahre und objektive Berichterstattung gewährleistet.
- Journalistische Sorgfaltspflicht: Bedeutet gründliche Recherche, vollständige Informationen, objektive Wortwahl und eindeutige Hinweise auf Quellen.
- Persönlichkeitsrecht: Abwägung zwischen Informationsinteresse der Öffentlichkeit und Schutz des Privatlebens.
- Trennung von Werbung und Berichterstattung: Bezahlte Veröffentlichungen müssen klar als Werbung erkennbar sein.
- Nachrichtenwert (oder Nachrichtenfaktoren): Kriterien, nach denen Journalisten bewerten, ob eine Nachricht berichtenswert ist, z.B. Aktualität, Relevanz, Nähe, Konfliktpotenzial, Prominenz und Emotionen.
Um Journalismus kann es sich bei des Stadtpfarrers „Impulsen“ demnach definitiv nicht handeln. Bis auf die Persönlichkeitsrechte (abgesehen vielleicht von denen des Verfassers selbst) erfüllen diese Beiträge keines dieser Kriterien.
Oder genügen eine Kategorisierung eines Beitrags in eine Rubrik „Kirche“ und die Nennung des Berufes des Verfassers als Hinweis darauf, dass es mit dem Wahrheitsanspruch, der Glaubwürdigkeit oder, wie im heutigen Beitrag, und mit der intellektuellen Redlichkeit im Umgang mit der mehr als fragwürdigen biblischen Textquelle nicht weit her ist?
Sollte es nicht im Interesse des Newsanbieters sein, sich von diesen Inhalten zumindest klar zu distanzieren? Zum Beispiel durch einen Hinweis wie „Dient nur zur Unterhaltung“ – oder noch treffender: „Kirchliche Dauerwerbesendung“?
Das frage ich mich bei religiösen Verkündigungen in allen Medien, bei denen man eigentlich davon ausgeht, dass sie sich journalistischen Grundwerten verpflichtet fühlen.









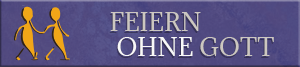
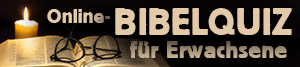
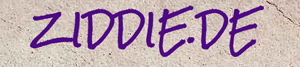


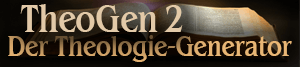

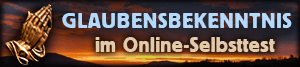
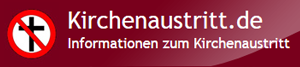
Ist schon interressant, wie gut dieser Selbstläufer seit hunderten von Jahren funktioniert…
Die Kirche kann sich getrost darauf verlassen, dass kaum einer wirklich dieses Drecksbuch liest.
Die wenigen, die dies tun sind seit Geburt an derartig indoktriniert, dass der Wort- und Sinngehalt derartiger Passagen einfach für nichtig erklärt bzw. ins Gegenteil verkehrt wird.
Der grosse schweigende Rest der „Traditionschristen“ gibt sich mit dem Gedanken zufrieden: „Ich bin Christ und somit einer von den Guten“, volkommen egal was dies bedeutet.
Wenn das alles nicht so BIZARR wäre, nicht das Blut von abertausenden Opfern dran kleben würde, müsste man vor Lachen heulen ob dieser geistigen Abgründe!!!
Was für ne SHIT-SHOW!!!
Damit konfrontiert kucken diese Leute dann wie die Lämmer und stammeln:
„Aber Gott ist doch die reine Liebe…“
Wie kann man einen Menschen nur so brechen, dass er gedankenlos diesen absurden WAHNSINN gut heist?!
Die Rosinenpickerei der Religionsvertreter ist ja allgemein bekannt. Man denke nur an die Sonntagsprediger (einschliesslich denen vom WzS), die seit Jahr und Tag nichts anderes tun als Rosinen zu picken. Ich vermute mal, dass Markus 16,16 oder die im Beitrag zitierten Hass-Psalmen oder die Geschichte vom Richter Jephta, der seine Tochter dem Jahve opfert oder vom Prophet Elija, der 42 Kinder wilden Bären vorwirft, sehr selten in Predigten thematisiert werden, dafür aber die Bergpredigt umso öfter, wobei man auch hier durchaus viel Kritisches anmerken könnte, was aber nie geschieht.
Ein Grund von vielen, dass die christliche Religion seit Jahrzehnten an Vertrauens- und Glaubwürdigkeit verliert, liegt auch darin begründet, dass die Verfügbarkeit der Bibel im Internet mittlerweile allumfassend ist. Ein Kauf ist nicht mehr erforderlich. Ein Klick, und der g a n z e Text ist von A bis Z in allen Sprachen und allen Versionen kostenfrei lesbar. Betonung liegt auf „ganz“.
Man muss die Texte noch nicht einmal selbst lesen, denn es gibt mittlerweile genug findige und kluge Köpfe, die die Widersprüchlichkeiten und Perversionen der Bibel akribisch und erschöpfend blosslegen und offenkundig machen – wie z. B. AWQ, BibViz, Evil Bible, Ketzer 2.0, MGEN, etc. Die Tatsache allein, dass es sie gibt, ist wichtig, nicht unbedingt nur die Klicks. Und man kann eben nachschlagen und nachvollziehen, was aufgedeckt wurde, nachdem man sich die Augen gerieben hat.
Früher spekulierte die Priesterschaft darauf, dass die Bibel wenig gelesen wurde und noch früher, dass die Bibel wegen Analphebetismus gar nicht gelesen werden konnte, oder es sogar zeitweise verboten war, sie zu lesen.
In die Köpfe der Gläubigen wurde nur das infiltriert, was die klerikalen Rosinenpicker für opportun hielten. Und nur das blieb dann auch in den Köpfen hängen.
Heutzutage ist diese Gehirnwäsche – zumindest in Ländern ohne massive Einflussnahme der Religion auf Politik und Gesellschaft – nicht mehr möglich.
Entscheidend ist nicht, dass die Rosinenpickerei nach wie vor praktiziert wird, sondern dass es ganz einfach möglich ist, diese als fulminante Heuchelei, wenn nicht gar bewusste Lügerei, zu entlarven, ad absurdum zu führen und im www. zu publizieren.