Der jüngste Impuls von Stadtpfarrer Stefan Buß (veröffentlicht am 8.10.25 (!) von osthessen-news.de) zum Heiligen Franziskus von Assisi bietet eine gute Gelegenheit, über die Grenzen religiöser Tierethik und die Problematik hagiographischer Argumentation nachzudenken.
Während der Text vorgibt, eine zeitgemäße Botschaft zu vermitteln, offenbart er bei genauerer Betrachtung die typischen Schwächen religiöser Moral: mystifizierte Begründungen, allegorische Verschleierung und die Vermischung von Legende und Wirklichkeit.
tl;dr: Hauptkritikpunkte
- Heiligenverehrung als problematische moralische Autorität – statt rationaler Argumente
- Biologische Unmöglichkeit der Jesaja-Vision – Ökosysteme funktionieren durch Räuber-Beute-Beziehungen
- Die Schwäche allegorischer Argumentation – wenn selbst der „Wolf von Gubbio“ wahrscheinlich metaphorisch gemeint war
- Fehlende Übertragbarkeit religiöser Begründungen – für säkulare Menschen nicht nachvollziehbar
- Symbolpolitik statt praktischer Tierschutz – Tiersegnungen ändern nichts an Massentierhaltung
Die Heiligenverehrung als moralischer Irrweg
Zunächst fällt auf, dass die gesamte ethische Argumentation auf der Autorität eines mittelalterlichen Heiligen beruht. Warum sollte die Lebensweise eines Mannes aus dem 13. Jahrhundert, der aufgrund religiöser Visionen sein Vermögen aufgab, als moralisches Vorbild für das 21. Jahrhundert dienen? Die Heiligenverklärung verhindert eine kritische Auseinandersetzung: Franziskus wird nicht als historische Person mit Stärken und Schwächen betrachtet, sondern als übermenschliches Ideal stilisiert.
Diese „Aura der Friedfertigkeit“, die angeblich wilde Tiere zahm macht, ist nichts weiter als hagiographische Fantasie. Wölfe ändern ihr Verhalten nicht aufgrund menschlicher Heiligkeit, sondern aufgrund von Konditionierung, Nahrungsverfügbarkeit und biologischen Faktoren. Die Behauptung, Franziskus‘ besondere „Vollkommenheit“ habe Tiere beeinflusst, ist aus naturalistischer Sicht schlicht unhaltbar.
Jesaja-Visionen statt ökologischer Realität
Besonders problematisch ist der Rückgriff auf die Jesaja-Prophezeiung vom Tierfrieden. Hier wird eine poetische Vision aus der Bronzezeit zur Grundlage eines angeblich modernen Tierverständnisses gemacht. Der Text selbst gibt zu, dass das „Gesetz vom Fressen und Gefressen werden“ in die Schöpfung „eingeschrieben“ ist – interpretiert dies aber als Mangel, der einer paradiesischen „neuen Schöpfung“ bedarf.
Dies offenbart ein fundamentales Missverständnis der Natur: Ökosysteme funktionieren durch Räuber-Beute-Beziehungen. Ein Löwe, der „Stroh wie das Rind“ frisst, wäre kein Löwe mehr, sondern eine biologische Unmöglichkeit. Die Evolution hat über Millionen Jahre komplexe Nahrungsketten hervorgebracht, die nicht „mangelhaft“ sind, sondern funktional. Die religiöse Sehnsucht nach einer harmonisierten Natur, in der alle Lebewesen friedlich koexistieren, entspringt anthropozentrischer Projektion, nicht ökologischer Einsicht.
Der „Wolf von Gubbio“: Allegorie als Argumentationsmuster
Aufschlussreich ist die beiläufige Bemerkung, dass es sich beim berühmten „Wolf von Gubbio“ vermutlich um eine Allegorie handele – möglicherweise sei ein Raubritter gemeint gewesen. Diese Einräumung untergräbt die gesamte Argumentationsstruktur: Wenn die bekannteste Tier-Geschichte über Franziskus gar keine echte Tier-Geschichte ist, warum sollten wir anderen Legenden über seine angebliche Tierkommunikation Glauben schenken?
Der Text versucht, diese Schwäche zu kaschieren, indem er behauptet, der „Wirkmechanismus auf Tier und Mensch“ sei „derselbe“. Doch das ist er eben nicht. Ein Mensch mag durch Güte und Sympathie zur Verhaltensänderung bewegt werden; ein Wolf reagiert auf ganz andere Faktoren. Diese Gleichsetzung verwischt die Grenzen zwischen Mythos und Realität auf problematische Weise.
Religiöse Motivation vs. säkulare Ethik
Buß gibt selbst zu, dass Franziskus‘ Haltung „klar religiös (christologisch) motiviert“ war. Genau hier liegt das Problem: Eine Tierethik, die darauf basiert, dass Tiere auf einen Schöpfergott „verweisen“ und Teil einer „göttlichen Familie“ sind, ist für Nicht-Gläubige nicht nachvollziehbar und rational nicht begründbar.
Moderne, säkulare Tierethik argumentiert mit Leidensfähigkeit, Bewusstsein, ökologischer Verantwortung und evolutionärer Verwandtschaft. Sie benötigt keine Heiligen, keine Schöpfungsmythen und keine göttlichen Familienbande. Peter Singer, Tom Regan und andere Tierethiker haben überzeugend dargelegt, warum wir Tiere schützen sollten – ohne ein einziges Mal Franziskus oder Jesaja zu bemühen.
Die Grenzen der franziskanischen Tierliebe
Auch inhaltlich bleibt die franziskanische Tierethik problematisch. Franziskus lebte in einer vorindustriellen Gesellschaft, in der Tierausbeutung ein Bruchteil dessen war, was heute geschieht. Seine „Armut“ mag persönliche Verzichtleistung gewesen sein, aber sie bot keine systematische Lösung für strukturelle Probleme. Das Kloster am Frauenberg, vor dem heute Tiersegnungen stattfinden, war selbst jahrhundertelang Teil eines Systems, das auf tierischer Arbeitskraft und Ressourcennutzung beruhte.
Zudem: Wenn alles „um seiner selbst willen da“ ist, wie begründet man dann ethisch, welche Tiere geschützt werden und welche nicht? Gilt das auch für Parasiten, Bakterien, Viren? Die franziskanische Geschwisterrhetorik klingt poetisch, löst aber keine konkreten ethischen Dilemmata.
Tiersegnungen: Symbolpolitik statt Strukturwandel
Die erwähnten Tiersegnungsgottesdienste sind symptomatisch für religiöse Tierethik: viel Symbolik, wenig bzw. keine Substanz. Während Haustiere gesegnet werden, werden in Deutschland täglich Millionen Tiere unter teils qualvollen Bedingungen gehalten und geschlachtet – oft mit dem Segen derselben Kirchen, die Franziskus verehren. Die katholische Kirche hat sich historisch nie konsequent gegen Massentierhaltung positioniert und lässt an kirchlichen Einrichtungen häufig konventionelle Produkte zu.
Ein echter Beitrag zum Tierschutz wäre nicht die Beschwörung mittelalterlicher Heiliger, sondern: Eintreten für strengere Tierschutzgesetze, Umstellung kirchlicher Kantinen auf pflanzliche Kost, Abschaffung von Tieropfersymbolik in der Liturgie, kritische Auseinandersetzung mit biblischen Texten, die Tiere zu menschlichen Ressourcen degradieren.
Fazit: Ethik braucht keine Heiligen
Der Impuls von Stefan Buß zeigt exemplarisch, warum religiöse Ethik an ihre Grenzen stößt: Sie ersetzt rationale Argumentation durch mythische Erzählungen, begründet Moral durch übermenschliche Vorbilder statt durch nachvollziehbare Prinzipien und verwechselt poetische Symbolik mit praktischer Problemlösung.
Wir brauchen keinen Franziskus, um zu erkennen, dass Tiere leidensfähige Wesen sind, die unseren Schutz verdienen. Wir brauchen keine Jesaja-Prophezeiungen, um ökologische Verantwortung zu übernehmen. Und wir brauchen keine Tiersegnungen, um gegen die systematische Ausbeutung von Tieren einzutreten.
Was wir brauchen, ist eine säkulare, wissenschaftlich fundierte und konsequent angewandte Tierethik – ohne den Umweg über mittelalterliche Wundererzählungen und bronzezeitliche Paradiesvisionen. Denn Mitgefühl mit anderen Lebewesen sollte nicht von religiösen Überzeugungen abhängen, sondern von unserer Fähigkeit, Leiden zu erkennen und danach zu handeln.
In diesem Sinne: Weniger Heiligenverehrung, mehr evidenzbasierte Ethik. Weniger Tiersegnungen, mehr Tierschutz. Weniger Mythos, mehr Moral.
Text mit KI bearbeitet









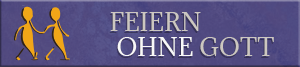
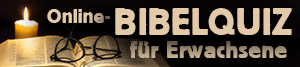
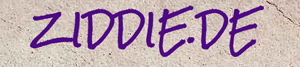


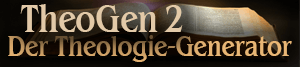

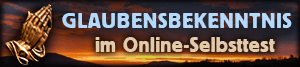
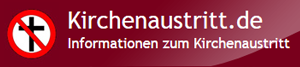
Ja, das waren noch Zeiten, als die Symbolkraft religiöser Rituale und phantastische Heiligengeschichten das Gottesvölkchen zum Staunen brachte und bei Laune hielt.
Heutzutage ist man soweit, dieses Brimborium durchschauen zu können und zu erkennen, was letztlich dahinter steckt:
Das Dogma von der Unveränderbarkeit der Welt und des Menschen.
Die Armut, das Elend, die Ungerechtigkeit, die Zerstörung der Natur etc. sollen nur ja nicht angetastet, sondern nur verwaltet werden. Almosen geben und Trostpflästerchen kleben, mehr ist nicht nötig und auch nicht erwünscht.
Und damit das nicht so augenfällig wird, legt man viel Wert auf die Schicksalsergebenheit des Gottesvolkes mit der Hoffnung, dass die Leidenden und Gottvertrauenden das Wirken der Kirchen möglichst lange für die Gnade Gottes, für seine Barmherzigkeit, für Nächstenliebe und für ähnliche Tugenden halten.
Die Religion braucht das Elend wie der Fisch das Wasser.
Gäbe es das Paradies auf Erden, womit könnten dann ein Gott, resp. seine Hilfstruppen, noch drohen?
Kein soziales Werk, keine christliche Soziallehre, keine Sozialenzyklika, keine Caritas, keine Spenden, keine sonstigen christlichen Wohltätigkeitsaktivitäten haben je eine wirkliche, fundamentale Veränderung zum Besseren, die man so nennen dürfte, bewirkt, oft sogar das genaue Gegenteil.
Diese unsägliche, hochgejubelte Mutter Teresa ist dafür ein „leuchtendes“ Beispiel.