Zusammen einsam – das Wort zum Wort zum Sonntag, verkündigt von Magdalena Kiess, veröffentlicht am 11.10.2025 von ARD/daserste.de
Darum geht es
Frau Kiess macht aus Einsamkeit ein Gottesproblem. Aber: Soziale Themen brauchen menschliche Lösungen, keine Theologie.Die Strategie: Vom Alltäglichen zum Übernatürlichen
Magdalena Kiess beginnt ihr „Wort zum Sonntag“ mit einer sympathischen, nachvollziehbaren Erfahrung: dem Umzug in eine neue Nachbarschaft, der Freude über hilfreiche Menschen, dem Kontrast zwischen Anonymität und Gemeinschaft. Soweit, so menschlich.
Doch dann vollzieht sich – und das ist die klassische Strategie religiöser Verkündigung – ein rhetorischer Kunstgriff: Das rein soziale Phänomen wird religiös aufgeladen und letztlich zur Gottesfrage umgedeutet.
Einsamkeit als gesellschaftliches Problem – ja! Als theologisches – nein.
Die Zahlen, die Kiess nennt, sind real und alarmierend: 60 Prozent der Deutschen fühlen sich immer wieder einsam, besonders junge Menschen sind betroffen. Einsamkeit macht tatsächlich krank, sie ist ein ernstzunehmendes gesellschaftliches Problem. Hier leistet der Beitrag zunächst Wichtiges: Er benennt ein Tabu, macht auf eine Volkskrankheit aufmerksam.
Doch anstatt die realen Ursachen dieser Einsamkeit zu analysieren – soziale Fragmentierung, Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen, digitale Scheinverbindungen, Individualisierungsdruck, fehlende öffentliche Räume der Begegnung –, springt Kiess zu einer 3000 Jahre alten Textsammlung: „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist“, zitiert sie aus der Genesis.
Die theologische Umleitung
Besonders problematisch wird es, wenn konkrete zwischenmenschliche Lösungen – wie die Initiative #melddichmalwieder oder einfach die Bereitschaft, auf Nachbarn zuzugehen – mit einem transzendenten „Dreiklang“ verknüpft werden: Beziehung zu anderen, zu sich selbst, und zu Gott.
Hier zeigt sich das Grundproblem religiöser Deutung: Sie suggeriert, dass menschliche Verbindungen erst durch eine göttliche Dimension vollständig werden. Kiess formuliert es explizit: Selbst in guten Beziehungen „bleibt manchmal eine kleine Lücke“ – und diese Lücke, so die theologische Pointe, füllt Gott.
Diesem „Lückenbüßer-Gott“ aka God of the Gaps begegnet man recht oft, wenn man sich mit Religiösen und ihren Glaubensgewissheiten auseinandersetzt.
Die Lücke als Geschäftsmodell
Aus humanistischer Sicht ist diese Argumentation gleich mehrfach fragwürdig:
Erstens pathologisiert sie menschliche Beziehungen. Die Vorstellung, dass zwischenmenschliche Nähe grundsätzlich unvollständig ist und einer göttlichen Ergänzung bedarf, wertet die reale, irdische Verbundenheit ab. Sie schafft ein künstliches Mangelgefühl.
Zweitens bietet sie eine Scheinalternative. Menschen, die „nicht können“ (also nicht glauben können oder wollen), werden implizit ausgeschlossen von der Möglichkeit, diese „Lücke“ zu füllen. Die Formulierung „wer kann, darf darauf vertrauen“ klingt großzügig, ist aber subtil exkludierend.
Drittens lenkt sie von konkretem Handeln ab. Statt politische und soziale Lösungen für Einsamkeit zu fordern – mehr Gemeinschaftsräume, bessere Arbeitsbedingungen, Nachbarschaftsprojekte, psychologische Unterstützung –, verweist sie auf einen unsichtbaren Tröster.
Martin Buber ohne Gott
Interessant ist, dass Kiess Martin Buber zitiert: „Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“ Was sie verschweigt: Bubers dialogisches Prinzip funktioniert auch ohne theistische Überzeugungen. Die Qualität menschlicher Begegnung – das authentische Ich-Du-Verhältnis – braucht keine göttliche Instanz. Sie entsteht in der Unmittelbarkeit zwischen Menschen.
Aus säkularer Sicht ist die existenzielle Erfahrung, dass wir niemals vollständig in einem anderen Menschen aufgehen können, keine „Lücke“, die gefüllt werden muss. Sie ist vielmehr Teil der conditio humana – der Tatsache, dass wir separate Bewusstseine in separaten Körpern sind. Diese Getrenntheit anzuerkennen, ohne sie religiös zu überhöhen, ist ein Zeichen von Reife.
Was wirklich gegen Einsamkeit hilft
Die Forschung zeigt klar, was gegen Einsamkeit wirkt:
- Niedrigschwellige soziale Kontakte: genau das, was Kiess‘ neue Nachbarn tun
- Sinnvolle Tätigkeiten in Gemeinschaft
- Strukturen, die Begegnung ermöglichen (Vereine, Nachbarschaftstreffs, Gemeinschaftsgärten)
- Psychologische Unterstützung bei chronischer Einsamkeit
- Gesellschaftliche Solidarität statt Leistungsdruck
Keiner dieser Punkte benötigt einen Gottesbezug.
Im Gegenteil: Die Geschichte zeigt, dass religiöse Gemeinschaften zwar Verbundenheit schaffen können, aber oft um den Preis der Exklusion Andersdenkender.
Das säkulare Liebesgebot
Kiess zitiert das „christliche Liebesgebot“ – und übersieht geflissentlich, dass dieses weder christlich noch göttlich ist. Die Goldene Regel findet sich in praktisch allen Kulturen, auch in explizit areligiösen Ethiksystemen. Menschliche Empathie, Reziprozität und Kooperation sind evolutionär entstandene Eigenschaften sozialer Primaten – nicht göttliche Gebote.
Die Aufforderung, andere und sich selbst zu achten, ist universell humanistisch. Sie braucht den Zusatz „und Gott“ nicht. Tatsächlich könnte man argumentieren, dass die Verschiebung der Verantwortung auf eine göttliche Instanz gerade die Eigenverantwortung schwächt, die für echte Verbundenheit nötig ist.
Fazit: Vereinnahmung eines sozialen Problems
Das „Wort zum Sonntag“ bedient sich hier einer bewährten Technik: Es nimmt ein reales, drängendes gesellschaftliches Problem auf, zeigt Empathie, bietet erste praktische Ansätze – und vereinnahmt dann das Ganze für religiöse Botschaften. Die implizite Logik: Ohne Gott bleibt eine Lücke, ohne Glauben ist Verbundenheit unvollständig.
Aus humanistischer Sicht ist das nicht nur unnötig, sondern kontraproduktiv. Menschen brauchen gegen Einsamkeit keine Theologie, sondern einander. Sie brauchen keine „Verbindung zum großen Ganzen“ im religiösen Sinne, sondern ein Bewusstsein für ihre Verbundenheit als Mitmenschen, als Teil der Biosphäre, als sterbliche Wesen in einer endlichen Welt.
Die Nachbarn von Magdalena Kiess haben das Richtige getan: Sie haben die Tür geöffnet, Hilfe angeboten, Verbindung geschaffen. Das war menschlich, sozial, konkret – und brauchte keine göttliche Rechtfertigung.
Wenn wir Einsamkeit bekämpfen wollen, dann durch mehr Menschlichkeit, nicht durch mehr Religiosität. Die Lücke, von der Kiess spricht, ist keine kosmische – sie ist eine soziale. Und sie lässt sich nur sozial schließen.
#MenschlichkeitStattMetaphysik
tl;dr: Hauptkritikpunkte
1. Religiöse Vereinnahmung sozialer Probleme
- Einsamkeit wird von einem gesellschaftlichen zu einem theologischen Problem umgedeutet
- Reale Ursachen (Prekarisierung, Individualisierung, fehlende Begegnungsräume) werden nicht analysiert
2. Pathologisierung menschlicher Beziehungen
- Zwischenmenschliche Nähe wird als grundsätzlich unvollständig dargestellt
- Künstliches Mangelgefühl: „Lücke“ die nur Gott füllen kann
- Abwertung irdischer Verbindungen
3. Scheinalternative statt konkreter Lösungen
- Verweis auf unsichtbaren göttlichen Tröster statt politischer/sozialer Maßnahmen
- Ablenkung von wirksamen Strategien gegen Einsamkeit
- „Wer kann, darf vertrauen“ – subtile Exklusion Nicht-Gläubiger
4. Falsche Zuschreibung ethischer Prinzipien
- „Christliches“ Liebesgebot ist universell humanistisch
- Goldene Regel existiert kultur- und religionsübergreifend
- Empathie und Kooperation sind evolutionär, nicht göttlich
5. Philosophische Verdrehung
- Martin Bubers „Ich-Du“ funktioniert ohne Theismus
- Existenzielle Getrenntheit wird religiös instrumentalisiert
- Reife bedeutet: Conditio humana akzeptieren, nicht religiös überhöhen
6. Verschiebung von Verantwortung
- Eigenverantwortung für soziale Verbindung wird geschwächt
- Lösung liegt bei Menschen selbst, nicht bei Gott
- Praktische Hilfe der Nachbarn brauchte keine göttliche Rechtfertigung
Text mit KI bearbeitet









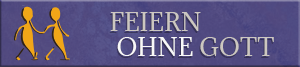
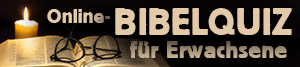
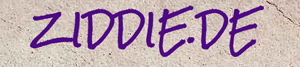


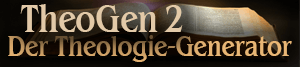

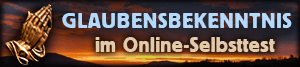
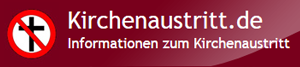
„wer kann, darf darauf vertrauen“
Dieses „können“ läuft bei Theologen wie z.B. Ratzinger auf einen grotesken Eiertanz hinaus: einerseits ist es z.B. ein „ungeschuldetes Geschenk“ Gottes oder seiner Gnade zu verdanken, andererseits muss immer DER Mensch schuld sein, wenns nicht klappt. Der „verschließt dann“ angeblich „die Augen vor der unendlichen Liebe Gottes“.
Ist doch schön, dass es die Religion als Selbsthilfegruppe gibt.
Da dürfen alle, die meinen Gottes Stimme zu hören, sich mit anderen Wahnsinnigen unter Anleitung eines Oberwahnsinnigen in ihrem Wahn gegenseitig bestätigen.
…Wenn denn nur mal einer hinter ihnen auch die Tür zusperren würde, wie das in geschlossenen Anstalten nun mal so üblich ist… 😉