Gedanken zum Impuls: Was hat die Hl. Elisabeth v. Thüringen uns heute noch zu sagen?, verkündigt von Stadtpfarrer Stefan Buß aus Fulda, veröffentlicht am 19.11.2025 von osthessen-news.de
Darum geht es
Die Kirche verklärt eine feudale Almosen-Aristokratin, die am selbstzerstörerischen Asketismus starb, zur Sozialheldin – und verschleiert dabei, dass echte Gerechtigkeit strukturelle Veränderungen statt paternalistischer Wohltätigkeit erfordert.Heute, am 19. November, erinnert die katholische Kirche an Elisabeth von Thüringen (1207–1231). Der Fuldaer Stadtpfarrer Stefan Buß nutzt die Gelegenheit, um sie als „zeitlose Prophetin der Menschlichkeit“ zu vermarkten. Schauen wir genauer hin, was diese Heiligenverehrung verschleiert – und was sie über kirchliche Geschichtsklitterung verrät.
1. „Radikale Nächstenliebe“ – oder feudale Almosenpolitik?
Der Text feiert Elisabeth für ihre „echte Solidarität“ mit Armen und Kranken. Was er verschweigt: Elisabeth war Teil jener feudalen Oberschicht, die durch Ausbeutung, Leibeigenschaft und Abgabensysteme erst die Armut produzierte, die sie dann mildtätig „linderte“.
Echte Solidarität hätte bedeutet, die strukturellen Ungerechtigkeiten des Feudalsystems anzuprangern – nicht individuelle Almosen zu verteilen, während das System unangetastet bleibt. Elisabeths „Nächstenliebe“ war klassisches charity statt justice: Sie bekämpfte Symptome, nicht Ursachen. Die Kirche verklärt bis heute diese paternalistische Fürsorge als Tugend, statt für soziale Gerechtigkeit und Umverteilung einzutreten.
2. „Freiheit des Herzens“ – oder religiöser Masochismus?
Elisabeth „gab alles auf, um in Armut Christus nachzufolgen“, heißt es bewundernd. Die historische Realität ist düsterer: Nach dem Tod ihres Mannes wurde die junge Witwe von der Hofgesellschaft verstoßen. Unter der Kontrolle ihres fanatischen Beichtvaters Konrad von Marburg lebte sie in selbst auferlegter Askese, ließ sich auspeitschen und starb mit nur 24 Jahren – vermutlich an den Folgen extremer Selbstkasteiung und Unterernährung.
Die Kirche glorifiziert diese selbstzerstörerische Lebensweise als „Nachfolge Christi“. Aus humanistischer Sicht war Elisabeth Opfer einer toxischen Frömmigkeit, die Leid und Selbstverleugnung als Heilsweg propagierte. Statt dies kritisch aufzuarbeiten, wird ihr früher Tod als „Martyrium“ verklärt.
3. „Glaube als Tat“ – die Instrumentalisierung für kirchliche PR
„Mystik und Tatkraft“ hätten Elisabeth ausgezeichnet, so der Pfarrer. Tatsächlich diente ihr kurzes Leben vor allem einem Zweck: der kirchlichen Propagandamaschinerie. Bereits vier Jahre nach ihrem Tod wurde sie heiliggesprochen – Rekordzeit! Warum? Weil die Kirche dringend populäre Identifikationsfiguren brauchte.
Die „Wunder“, die ihr zugeschrieben werden, folgen dem üblichen hagiographischen Muster: unbelegte Heilungsberichte, fromme Legenden, posthume Stilisierung. Historisch gesichert ist davon nichts. Aber die Kirche weiß: Emotionale Geschichten funktionieren besser als rationale Argumente.
4. Das „Rosenwunder“ – Märchenstunde statt Geschichte
Das berühmte Rosenwunder – Brot verwandelt sich in Rosen – wird selbst im kirchlichen Text vorsichtig als „Legende oder Symbol“ bezeichnet. Richtig: Es ist eine mittelalterliche Erfindung, die erst Jahrhunderte nach Elisabeths Tod auftaucht. Solche Wunderlegenden dienten dazu, den Status von Wallfahrtsorten zu erhöhen und Pilger (samt ihrem Geld) anzulocken.
Dass diese Märchen auch heute noch erzählt werden – in einer Zeit, in der wir die Naturgesetze verstehen – zeigt, wie die Kirche historische Wahrheit der erbaulichen Fiktion opfert.
5. „Gewissensfreiheit“ – ein Anachronismus
Der Text behauptet, Elisabeth habe „trotz Widerständen“ ihrem Gewissen gefolgt. Dies projiziert moderne Konzepte von Autonomie und Gewissensfreiheit in eine Zeit, in der diese Begriffe nicht existierten. Elisabeth handelte nicht aus aufgeklärtem Selbstbewusstsein, sondern aus religiöser Unterwerfung – unter die Gebote ihrer Kirche und ihres Beichtvaters.
Die Kirche, die Gewissensfreiheit jahrhundertelang bekämpfte (Inquisition, Index, Zensur), vereinnahmt nun posthum eine ihrer gehorsamen Töchter als Symbolfigur eben dieser Freiheit. Das ist historische Ironie – oder Geschichtsfälschung.
Was wir wirklich von Elisabeth lernen können
Nicht die Heiligenlegende, sondern die nüchterne historische Betrachtung ist lehrreich:
- Über die Grenzen religiöser Ideologie: Wie Glaubenssysteme Menschen zu selbstzerstörerischem Verhalten treiben können
- Über strukturelle vs. karitative Lösungen: Warum Almosen Machtverhältnisse zementieren statt auflösen
- Über kirchliche Geschichtspolitik: Wie Institutionen historische Figuren für ihre Zwecke instrumentalisieren
- Über die Kosten des Gehorsams: Was passiert, wenn Menschen ihre Autonomie religiösen Autoritäten opfern
Fazit: Humanismus statt Heiligenverehrung
Wer heute soziale Gerechtigkeit, Mitgefühl und Engagement fördern will, braucht keine mittelalterlichen Legenden. Wir brauchen:
- Evidenzbasierte Sozialpolitik statt religiös motivierter Wohltätigkeit
- Strukturelle Reformen statt individueller Almosen
- Menschenrechte statt göttlicher Gebote
- Kritisches Geschichtsbewusstsein statt frommer Verklärung
Die „zeitlose Prophetin der Menschlichkeit“ ist ein Marketingprodukt der Kirche. Die historische Elisabeth war eine tragische Figur – jung, manipuliert, ausgebeutet von einem religiösen System, das ihren Tod vier Jahre später zur Werbeveranstaltung nutzte.
Echte Nächstenliebe beginnt dort, wo wir Menschen als autonome Wesen mit Rechten anerkennen – nicht als Objekte religiöser Fürsorge oder hagiographischer Projektionen.











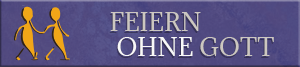
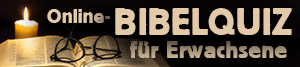
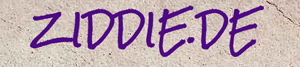


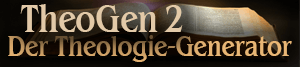

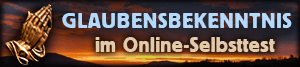
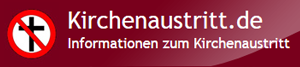
Es ist immer wieder schön zu lesen, wie all die Kirchenvertreter bis hin zum Papst die selbst gewählte Armut ihrer Heiligen anpreisen.
Komischerweise möchte aber kein einziger von ihnen genau so „heilig“ sein, bzw. auch nur ein Stückchen der eigenen Privilegien/Gelder abgeben!
Nebenbei stelle ich mir grade die Frage, ob es die sexuelle Spielart des Sado-Masochismus auch ohne den Einfluss jeglicher Religion geben würde…
Dieser ganze Erniedrigungsfetisch, Selbstgeisselung, Bestrafungsdrang, hat doch genau da seinen Ursprung.
Was denkt ihr darüber?