Gedanken zu: Impuls von Stefan Buß – Was sagt das Chistkönigsfest heute?, verkündigt von Stefan Buß, veröffentlicht am 22.11.25 von osthessen-news.de
Der Fuldaer Stadtpfarrer Stefan Buß lädt uns ein, Christus als „König unseres Lebens und der gesamten Schöpfung“ anzuerkennen. Als säkularer Humanist frage ich mich: Brauchen wir im 21. Jahrhundert wirklich noch Könige – selbst metaphorische?
Darum geht es
Das Christkönigsfest zementiert autoritäres Denken durch die Forderung nach Unterwerfung unter einen „König“, vertöstet Menschen auf ein Jenseits statt sie zu eigenverantwortlichem Handeln im Hier und Jetzt zu ermutigen, und unterstellt, dass ethisches Verhalten nur durch religiöse Autorität möglich sei – was mündige, selbstbestimmte Menschen infantilisiert.Die problematische Königsmetapher
Beginnen wir mit dem Offensichtlichen: Die gesamte Begriffswelt des „Christkönigs“ stammt aus einer Zeit, in der Monarchien selbstverständlich waren und absolute Herrschaft als gottgewollt galt. Dass die katholische Kirche ausgerechnet 1925 – also nach dem Zusammenbruch der europäischen Monarchien – dieses Fest einführte, ist bezeichnend. Es war ein Versuch, in einer zunehmend demokratischen Welt an autoritären Strukturen festzuhalten.
Heute, in Zeiten, in denen wir Demokratie, Selbstbestimmung und Mündigkeit als Grundwerte betrachten, mutet es seltsam an, sich freiwillig unter die „Herrschaft“ einer Autorität zu stellen – sei sie nun irdisch oder fiktiv.
„Sein Reich ist nicht von dieser Welt“ – Weltflucht statt Weltverantwortung?
Pfarrer Buß zitiert Johannes 18,36: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt.“ Dieser Satz wirft mehr Fragen auf, als er beantwortet. Wenn das Reich Christi nicht von dieser Welt ist, warum sollen wir dann weltliche Strukturen nach seinen Prinzipien ausrichten? Und wenn es doch von dieser Welt ist – warum die explizite Distanzierung?
Diese Formulierung riecht nach Weltflucht: Die eigentlichen Probleme liegen in einer anderen, jenseitigen Sphäre. Das irdische Leid wird relativiert durch den Verweis auf ein kommendes Reich. Für Menschen, die hier und jetzt unter Ungerechtigkeit, Armut oder Diskriminierung leiden, ist das wenig tröstlich.
Die angebliche „Umkehr der Werte“
Der Stadtpfarrer kontrastiert weltliche Werte wie „Macht, Einfluss und Erfolg“ mit christlichen Werten wie „Demut, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit“. Diese Gegenüberstellung ist jedoch irreführend und vereinfachend.
Erstens: Humanistische und säkulare Ethik kennen Mitgefühl, Gerechtigkeit und gegenseitige Hilfe sehr wohl – und das ohne religiöse Begründung. Diese Werte sind keine Erfindung des Christentums, sondern grundlegende menschliche Eigenschaften, die sich evolutionär entwickelt haben und die wir in allen Kulturen finden.
Zweitens: Die Vorstellung, man brauche einen „König Christus“, um ethisch zu handeln, infantilisiert den Menschen. Sie unterstellt, dass wir ohne göttliche Autorität nicht in der Lage wären, Richtig von Falsch zu unterscheiden. Das widerspricht fundamental humanistischem Menschenbild, das auf Vernunft, Empathie und der Fähigkeit zur moralischen Urteilsbildung basiert.
Die fragwürdige Frage: „Wie würde Christus handeln?“
Buß lädt ein zu fragen: „Wie würde Christus in dieser Situation handeln?“ Diese Frage ist in mehrfacher Hinsicht problematisch:
- Historische Unklarheit: Wir wissen nicht mit Sicherheit, wie der historische Jesus wirklich war oder was er tatsächlich gesagt hat. Die biblischen Texte sind Glaubenszeugnisse, keine historischen Protokolle.
- Interpretationswillkür: Die Geschichte zeigt, dass sich mit „christlichen Werten“ so ziemlich alles begründen lässt – von der Sklaverei bis zur Befreiungstheologie, von Kreuzzügen bis zur Friedensbewegung.
- Moralische Selbstentmündigung: Statt selbst ethisch zu reflektieren, wird die moralische Autorität an eine externe Figur delegiert. Das verhindert eigenverantwortliches moralisches Denken.
Das „Hoffnungszeichen“ – Vertröstung auf später
Besonders problematisch ist der Schlussgedanke: Die „letzte Macht“ liege bei Christus, der „eines Tages alles Leid, jede Ungerechtigkeit und den Tod überwinden“ werde. Diese Vertröstung auf ein jenseitiges Reich oder eine ferne Zukunft wirkt lähmend auf die Gegenwart.
Aus humanistischer Sicht ist entscheidend: Wenn wir Ungerechtigkeit bekämpfen, Leid lindern und die Welt verbessern wollen, dann müssen wir es tun – hier und jetzt. Nicht ein König, nicht ein Gott, sondern wir Menschen tragen die Verantwortung für unsere Welt.
Die Hoffnung auf eine göttliche Intervention kann zum Quietismus führen: Warum sollte ich mich engagieren, wenn ohnehin Gott irgendwann alles richtet?
Fazit: Mündigkeit statt Königstreue
Das Christkönigsfest zementiert hierarchisches Denken und fordert Unterwerfung unter eine Autorität – selbst wenn diese als „liebevoll“ deklariert wird. Aus säkularer Perspektive brauchen wir keine Könige, auch keine metaphorischen. Wir brauchen mündige Menschen, die aus Vernunft und Mitgefühl heraus ethisch handeln.
Die Werte, die Pfarrer Buß anspricht – Gerechtigkeit, Solidarität, gegenseitige Hilfe – sind wichtig und richtig. Aber wir brauchen dafür keine religiöse Überhöhung. Wir brauchen keine Krone, auch keine aus Dornen. Wir brauchen Menschen, die ihre Verantwortung für diese Welt ernst nehmen – nicht weil ein König es befiehlt, sondern weil es das Richtige ist.
Was sagt das Christkönigsfest heute?
Es sagt: Unterwerfung ist eine Tugend, Hierarchie ist gottgewollt, und deine Verantwortung für diese Welt ist zweitrangig – weil irgendwann ein König kommt, der alles richtet.
Oder anders formuliert: Das Christkönigsfest ist ein anachronistisches Relikt, das autoritäre Strukturen religiös verklärt, während die Welt längst Demokratie, Mündigkeit und Selbstbestimmung als Grundwerte erkannt hat.









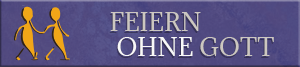
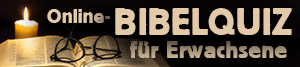
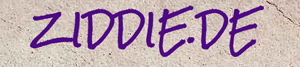


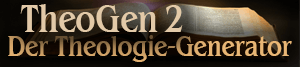

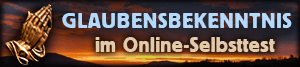
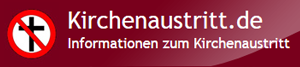
Reminds me of George Orwell (1984)…
Dieses stumfe Gefasel von angeblich „christlichen Werten“ geht mir total auf den Sack!
Diese Heuchelei, dass angeblich nur die, welche an einen imaginären Himmelszauberer glauben, der millionenfach Völkermord begangen haben soll und offensichtlich an einer narzisstischen Persönlichkeitstörung leidet, die einzig Guten unter den Menschen seien, das bringt mich echt in Rage!
Man bedenke, wieviel „Cherrypicking“, Selbstverleugnung und Sklavenmentalität dafür notwendig sind, bis hin zur Umkehr aller ethischen Werte.
„Selig der, welcher die kleinen am Stein zerschlägt“ u.ä. Verse, die Bibel ist voll davon…
„Massenpsychose“, ist das einzige Wort, was diesen Zustand trefflich beschreibt!
Und jeder von ihnen hat angeblich den Satz in der Bibel überlesen, in dem ihr Gott eindeutig zu verstehen gibt, dass er nur für das Volk Juda da ist, für niemand anderen sonst…
Frieden ist Krieg.
Liebe ist Hass..
Orwell lässt grüssen…
IHR DÄMLICHEN, SELBSTGEFÄLLIGEN, SCHAFE!!!MÄÄÄÄÄÄH!!!
Recht erhellend, was Wikipedia über die Motive des Begründers des ChristKönigsFests berichtet:
»Pius XI. verband mit der Einsetzung des Christkönigsfestes 1925 die Hoffnung auf Überwindung von „Zeitirrtümern“ wie Laizismus als Wurzel allen Übels („Pest, welche die menschliche Gesellschaft befallen hat“) und der Abkehr der Einzelnen und der Staaten von Gott.[20] Die Worte des Papstes wurden verstanden als Anspruch, „dass die Staaten und die Staatslenker die Pflicht haben, Christus öffentlich anzuerkennen“; das gesamte Staatsleben müsse nach den Grundsätzen Christi eingerichtet werden, der „absoluter Herr und Besitzer“ der Welt sei, auch wenn er auf die Ausübung seiner irdischen Herrschaft verzichtet habe. Die Staatslenker seien nur Verwalter Christi, und das Königtum Christi gebe den Völkern eine über ihnen stehende Einheit. Die Kirche wurde verstanden als „selbständige Gesellschaft, die ihr Amt unabhängig vom Staate ausüben muss“ und nicht von Staatsautorität abhängig sein kann.[21]«
Der Text spricht für sich aber ich habe mal ein paar Kernaussagen in eigenen Worten tabellarisch zusammengefasst:
– Laizismus ist die Wurzel allen Übels
– Laizismus ist die Pest
– alle Staaten müssen Gottes/Christus-Staaten sein
– Christus ist absoluter Herr und Besitzer der Welt
– die „Staatenlenker“ müssen sich Christus unterordnen
– die Kirche soll sich wie ein Staat im Staate verhalten