Gedanken zu: Impuls von Stefan Buß: Was uns der Herbst über das Leben sagen kann – veröffentlicht am 29.10.25 von Osthessennews.de
Darum geht es
Der Fuldaer Stadtpfarrer Stefan Buß lädt uns ein, im Herbst religiöse Botschaften zu erkennen. Doch brauchen wir wirklich einen Gott, um die Jahreszeiten zu verstehen? Eine Analyse aus atheistischer und humanistischer Perspektive.Die Poesie der Natur – ohne metaphysischen Überbau
Stadtpfarrer Buß beginnt mit einer Beobachtung, der wohl jeder zustimmen kann: Der Herbst zeigt uns die „Schönheit des Vergänglichen“. Soweit, so unproblematisch. Doch dann folgt der typische religiöse Kunstgriff: Aus einer natürlichen Beobachtung wird eine moralische Lektion konstruiert, aus einem biologischen Prozess eine göttliche Botschaft abgeleitet.
Schauen wir genauer hin: Bäume werfen ihre Blätter nicht ab, um uns etwas über „würdevolles Loslassen“ beizubringen. Sie tun es, weil sich durch evolutionäre Prozesse über Millionen Jahre ein hocheffizienter Mechanismus entwickelt hat, um Ressourcen zu sparen und Frostschäden zu vermeiden. Laubbäume haben sich in gemäßigten Klimazonen durchgesetzt, weil die Strategie des saisonalen Blattabwurfs einen Überlebensvorteil bot. Das ist weder leise noch würdevoll – es ist schlicht funktional.
Der problematische Anthropomorphismus
Die religiöse Naturbetrachtung macht aus einem neutralen Prozess eine Metapher für menschliches Verhalten. Das ist nicht nur wissenschaftlich fragwürdig, sondern auch philosophisch problematisch. Denn sie projiziert menschliche Kategorien – Würde, Dankbarkeit, Weisheit – auf die Natur und liest sie dann als „Botschaft“ wieder heraus. Ein klassischer Zirkelschluss.
Noch deutlicher wird dies, wenn Buß vom „Rhythmus Gottes“ spricht. Hier wird aus einem beobachtbaren Naturphänomen – dem Jahreszeitenwechsel – ein göttlicher Plan konstruiert. Doch die Jahreszeiten entstehen durch die Neigung der Erdachse und die Rotation um die Sonne. Sie folgen den Gesetzen der Himmelsmechanik, nicht der Theologie.
Dankbarkeit ohne Adressat
Buß fordert uns auf, für die „Früchte unseres Lebens“ zu danken. Eine berechtigte Frage: Wem eigentlich? Und warum?
Aus humanistischer Perspektive ist Dankbarkeit durchaus wertvoll – aber nicht als religiöse Pflichtübung, sondern als psychologische Haltung. Studien zeigen, dass Menschen, die regelmäßig reflektieren, wofür sie dankbar sind, zufriedener leben. Doch diese Dankbarkeit braucht keinen göttlichen Empfänger. Wir können dankbar sein für die Zufälle unserer Geburt, für die Menschen in unserem Leben, für unsere eigene Fähigkeit zur Resilienz – ohne diese Dankbarkeit an eine übernatürliche Instanz zu adressieren.
Die Ernte, von der Buß spricht, ist das Ergebnis menschlicher Arbeit, günstiger Umstände und manchmal auch einfach Glück. Sie als „gereift“ zu bezeichnen, als hätte sie sich quasi von selbst entwickelt, unterschlägt die Anstrengungen und auch die Privilegien, die dazu führen, dass manche ernten können und andere nicht.
Das Problem mit dem „größeren Kreislauf“
Besonders problematisch wird Buß‘ Impuls, wenn er schreibt: „Sterben ist nicht das Ende, sondern Teil eines größeren Kreislaufs.“ Hier wird eine naturwissenschaftliche Beobachtung – der biologische Kreislauf von Werden und Vergehen – mit einer religiösen Jenseitsvorstellung verknüpft.
Ja, in der Natur gibt es Kreisläufe. Organische Materie wird zersetzt, ihre Bestandteile werden von neuen Organismen aufgenommen. Aber das bedeutet nicht, dass das individuelle Bewusstsein, das Ich-Erleben, die Persönlichkeit eines Menschen über den Tod hinaus fortbesteht. Ein Blatt, das verrottet, „lebt“ nicht im neuen Baum weiter – seine Moleküle werden recycelt, mehr nicht.
Diese Vermischung von biologischem Stoffkreislauf und metaphysischer Unsterblichkeitshoffnung ist typisch für religiöse Naturlyrik: Sie verspricht Trost, indem sie wissenschaftliche Fakten mit unbelegten Glaubensaussagen vermengt.
Weisheit oder Notwendigkeit?
Buß schreibt, ein Baum verliere seine Blätter „nicht aus Schwäche, sondern aus Stärke“. Das klingt inspirierend, ist aber biologisch unsinnig. Ein Baum trifft keine bewusste Entscheidung, er „weiß“ nichts und handelt nicht aus „Weisheit“. Hormone wie Auxin und Abscisinsäure steuern den Blattabwurf als Reaktion auf sinkende Temperaturen und Lichtmangel. Das ist ein automatischer Prozess, keine weise Lebensentscheidung.
Die Aufforderung, vom Baum zu lernen und „Ballast abzuwerfen“, mag als Lebensratschlag gut gemeint sein. Aber sie unterschlägt, dass Menschen im Gegensatz zu Bäumen bewusste Entscheidungen treffen können und müssen. Was für mich „Ballast“ und was „wesentlich“ ist, kann ich nur durch rationale Reflexion, im Dialog mit anderen und auf Basis meiner Werte herausfinden – nicht durch das Nachahmen biologischer Automatismen.
Die säkulare Alternative
Was bleibt, wenn wir den religiösen Überbau entfernen? Sehr viel, oder sogar: viel mehr!
Der Herbst kann uns tatsächlich zum Nachdenken anregen – nicht weil er uns eine göttliche Botschaft übermittelt, sondern weil wir Menschen Bedeutung konstruierende Wesen sind. Wir können:
- Die Schönheit der Natur ästhetisch würdigen, ohne sie theologisch überhöhen zu müssen
- Über Vergänglichkeit reflektieren, ohne an ein Leben nach dem Tod glauben zu müssen
- Dankbarkeit kultivieren für günstige Umstände und die Menschen, die uns unterstützen
- Lernen loszulassen, was uns nicht mehr nutzt – aus psychologischer Einsicht, nicht aus religiösem Gehorsam
- Die Wissenschaft schätzen, die uns erklärt, warum die Blätter fallen
- Unsere Endlichkeit akzeptieren als Teil der conditio humana, ohne sie durch Jenseitsversprechen zu leugnen
Fazit: Erkenntnis statt Offenbarung
Stadtpfarrer Buß‘ Herbstimpuls ist ein Musterbeispiel religiöser Naturromantik: Er nimmt beobachtbare Phänomene, lädt sie mit religiöser Bedeutung auf und verkauft sie als göttliche Botschaft. Das mag tröstlich sein, aber es ist weder rational noch ehrlich.
Eine humanistische, naturalistische Weltsicht braucht keine göttlichen Rhythmen, um den Herbst wertzuschätzen. Sie akzeptiert die Natur, wie sie ist – grandios, gleichgültig und ohne höheren Zweck. Und findet darin nicht weniger, sondern mehr Anlass zum Staunen: dass wir als bewusste Wesen Teil dieser gewaltigen, zwecklosen Evolution sind und für einen kurzen Moment Bedeutung schaffen können in einem Universum, das keine kennt.
Das ist keine kalte, trostlose Weltsicht. Es ist eine ehrliche. Und Ehrlichkeit ist die Grundlage jeder echten Weisheit – im Herbst wie in jeder anderen Jahreszeit.









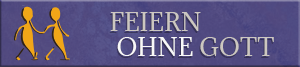
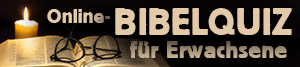
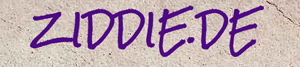


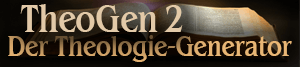

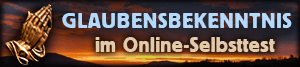
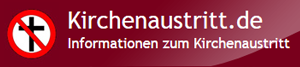
Die schaffen wirklich, ihren Gott in jede noch so banale Thematik hinein zu zwängen…
Ich spiel mal mit und ersetze den Begriff „Herbst“ durch das Wort „Kühlschrank“:
Die Leere in meinem Kühlschrank ist ein göttliches Zeichen:
-dass meine Völlerei dem Herren ein Gräul ist.
-dass ich meine gottgegebene Armut demütig zu akzeptieren habe.
-dass Gott schon dafür sorgen wird, dass zügig Nachschub eintrifft.
-dass der Heilige Geist in Wahrheit das Krümelmonster ist und mir auf diese Art beweist, dass nicht nur Kekse lecker sind.
Eins davon wirds mit Sicherheit sein. Sucht euch was aus, ihr Christen.
Ich geh in der Zwidchenzeit mal fix einkaufen! 😉