„Sorry“ sagen als moralische Pflicht? – Das Wort zum Wort zum Sonntag, verkündigt von Pfarrer Höner, veröffentlicht am 18.10.2025 von ARD/daserste.de
Darum geht es
Das aktuelle „Wort zum Sonntag“ von Pfarrer Alexander Höner zum Thema Entschuldigung offenbart unfreiwillig ein fundamentales Problem religiöser Ethik: die Bevorzugung ritualisierter Gesten gegenüber authentischer moralischer Reflexion.Die Kernthese: Heuchelei als Tugend
Der Sprecher argumentiert allen Ernstes, dass es „gut“ sei, sich zu entschuldigen, auch wenn man es „mit seinem Herzen noch nicht so weit“ ist. Die Geste soll dem Gefühl vorauseilen – in der Hoffnung, das Herz würde irgendwann „idealerweise“ folgen.
Das ist eine bemerkenswert ehrliche Beschreibung dessen, was Religion seit Jahrtausenden praktiziert: Die Priorisierung äußerer Konformität über innere Überzeugung.
Aber nennen wir es doch beim Namen: Eine Entschuldigung ohne Einsicht ist keine Entschuldigung – sie ist Theater. Sie ist eine soziale Performance, die Konflikte oberflächlich beigelegt, ohne dass echte Veränderung stattfindet.
Das Fidji-Beispiel: Kulturrelativismus als Argument
Besonders aufschlussreich ist die Anekdote über die Fidschi-Inseln, wo man sich routinemäßig entschuldigt, „falls man dem Gastgeber jemals Unrecht getan haben könnte – bewusst oder unbewusst.“
Der Sprecher präsentiert dies als positive Praxis. Doch was sagt uns das eigentlich?
- Die Inflation der Entschuldigung: Wenn man sich für alles und nichts entschuldigt, verliert die Geste jede Bedeutung. Sie wird zur leeren Höflichkeitsfloskel.
- Präventive Schuldgefühle: Die Vorstellung, man könnte sich unbewusst schuldig gemacht haben und müsse sich vorsorglich entschuldigen, ist psychologisch toxisch. Sie kultiviert ein diffuses Schuldgefühl ohne konkreten Anlass – eine Spezialität religiöser Indoktrination.
- Kulturrelativismus: Der Sprecher übernimmt unkritisch eine kulturelle Praxis, die in seinem eigenen Kontext als unehrlich gelten würde. Warum? Weil sie sein Argument stützt.
Das NS-Schuldbekenntnis: Ein problematischer Vergleich
Der Verweis auf Willy Brandts Kniefall und das Stuttgarter Schuldbekenntnis soll die These stützen, dass „vorauseilende Gesten“ wertvoll seien. Doch dieser Vergleich ist aus mehreren Gründen problematisch:
Erstens: Sowohl Brandt als auch die Verfasser des Schuldbekenntnisses hatten sehr wohl eine innere Überzeugung. Sie handelten gegen Widerstände, aber nicht ohne Einsicht. Der Vergleich hinkt also fundamental.
Zweitens: Das Stuttgarter Schuldbekenntnis kam viel zu spät und war viel zu zaghaft. Die evangelische Kirche hatte sich während des NS-Regimes weitgehend angepasst, antisemitische Theologie gepredigt und weggeschaut. Die „Deutschen Christen“ hatten Jesus arisiert und das Alte Testament aus der Bibel streichen wollen. Von offener Kollaboration bis zu feigem Schweigen reichte das Spektrum kirchlichen Verhaltens.
Ein „Sorry“ nach dem Holocaust – das ist nicht „vorauseilende Versöhnung“, das ist das absolute Minimum. Und selbst dieses Minimum erfolgte nur unter massivem internationalem Druck.
Drittens: Die Kirche nutzt hier geschickt historische Beispiele, um von ihrer eigenen, fortdauernden Schuld abzulenken: den systematisch vertuschten Missbrauchsskandalen, der Diskriminierung von Frauen und LGBTQ+-Menschen, dem jahrhundertelangen Machtmissbrauch. Wo ist das kirchliche Schuldbekenntnis für zehntausende missbrauchte Kinder? Wo ist der Kniefall vor den Opfern?
Die religiöse Logik: Ritual statt Reflexion
Was der Beitrag eigentlich propagiert, ist eine zutiefst religiöse Denkweise: Die Form ist wichtiger als der Inhalt. Das Ritual ersetzt die Reflexion.
Das kennen wir aus allen Religionen:
- Man beichtet seine Sünden, spricht drei „Vaterunser“ – und alles ist vergeben.
- Man opfert ein Tier, vollzieht das richtige Ritual – und die Götter sind besänftigt.
- Man entschuldigt sich pro forma – und die soziale Ordnung ist wiederhergestellt.
Die Frage nach echter Verantwortung, nach Wiedergutmachung, nach struktureller Veränderung wird elegant umgangen. Hauptsache, die Geste stimmt.
Säkulare Ethik: Verantwortung statt Ritual
Eine humanistische, säkulare Ethik würde anders ansetzen:
Echte Entschuldigung erfordert:
- Einsicht: Ich verstehe, was ich falsch gemacht habe und warum es falsch war.
- Empathie: Ich kann nachvollziehen, wie mein Handeln andere verletzt hat.
- Wiedergutmachung: Ich bin bereit, die Konsequenzen zu tragen und den Schaden zu beheben.
- Verhaltensänderung: Ich werde konkret daran arbeiten, den Fehler nicht zu wiederholen.
Alles andere ist bestenfalls ein erster Schritt – aber keine vollständige Entschuldigung.
Der Sprecher dreht das Verhältnis um: Die Geste kommt zuerst, die Einsicht „idealerweise“ irgendwann später. Das ist moralischer Opportunismus, keine Ethik.
Die Autoritäts-Falle: „Erst mal entschuldigst du dich!“
Bemerkenswert ist auch die Kindheitsanekdote. Der Vater zwingt den Jungen zur Entschuldigung. Keine Erklärung, warum das Abbrechen des Zweigs falsch war. Keine Hilfe beim Entwickeln von Empathie für die Nachbarin. Nur autoritärer Befehl: „Erst entschuldigst du dich, dann reden wir.“
Dies spiegelt perfekt das religiöse Weltbild: Gehorsam vor Verständnis. Man muss sich den Geboten unterwerfen, bevor man ihre Weisheit begreift (falls man sie je begreift).
Eine gute Erziehung würde anders vorgehen: Dem Kind erklären, warum sein Handeln problematisch war. Empathie entwickeln. Gemeinsam nach Lösungen suchen. Und dann – aus eigener Einsicht – eine Entschuldigung formulieren.
Fazit: Wenn „Sorry“ zur spirituellen Bypass wird
Dieser Beitrag zeigt exemplarisch, wie religiöses Denken echte moralische Entwicklung blockiert. Statt Menschen zu befähigen, Verantwortung zu übernehmen, bietet er billige Absolution durch leere Gesten.
Die Botschaft lautet: Sei nicht authentisch. Sei nicht ehrlich zu dir selbst. Vollziehe einfach die erwartete Geste – dein Herz wird (vielleicht, irgendwann, „idealerweise“) schon nachkommen.
Das ist keine Ethik. Das ist soziale Manipulation im Gewand der Moral.
Eine wirklich reife Gesellschaft bräuchte keine vorauseilenden Pro-forma-Entschuldigungen. Sie bräuchte Menschen, die fähig sind zur Selbstreflexion, zur Empathie, zur echten Verantwortungsübernahme. Die sich entschuldigen, weil sie es ehrlich meinen – nicht in der vagen Hoffnung, die Ehrlichkeit würde später noch folgen.
Aber vielleicht ist genau das das Problem: Eine solche Gesellschaft würde auch keine Kirchen mehr brauchen, die ihr vorschreiben, wann und wie sie „Sorry“ zu sagen hat.
Nachtrag zur kirchlichen Heuchelei:
Es ist schon bemerkenswert, dass ausgerechnet die Institution „Kirche“ uns belehren will, wie wichtig vorauseilende Entschuldigungen sind – während sie selbst Jahrzehnte brauchte, um sich zu ihren Missbrauchsskandalen zu bekennen. Und selbst heute noch werden Opfer vertröstet, Täter geschützt und strukturelle Aufarbeitung verhindert.
Vielleicht sollte die Kirche erst mal ihr eigenes Herz „nachholen“ lassen, bevor sie anderen Lektionen in Sachen Entschuldigung erteilt.









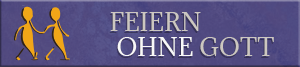
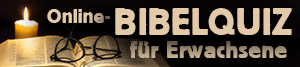
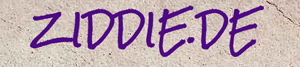


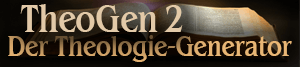

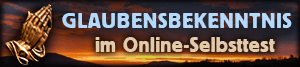
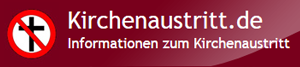
Mich stört der ganze Begriff „sich entschuldigen“, denn er ist, auch wenn im allgemeinen Sprachgebrauch üblich, definitiv falsch.
Man kann nur den anderen um VERZEIHUNG BITTEN, mit ehrlicher Reue, in der Hoffnung, dass einem vergeben wird, was letztendlich der Geschädigte zu entscheiden hat.
Gerade bei den Katholiken funktioniert diese Selbstverarschung perfekt.
Die rennen jeden Sonntag zur Beichte, fühlen sich danach rein und moralisch überlegen, um dann die gleichen „Sünden“ wieder zu begehen, wohlwissend, dass am nächsten Sonntag der Pfaffe wieder mit der (Schein-)Absolution winkt.
Hauptsache ein gutes Gewissen, mit dem man vor anderen angeben kann…
Heuchelei pur!
Aufrichtiges Verhalten geht definitiv anders.
„eine zutiefst religiöse Denkweise: Die Form ist wichtiger als der Inhalt. Das Ritual ersetzt die Reflexion.“
genau !
Habe auch meine Schwierigkeiten mit dem Wort „Entschuldigung“ (siehe Kommentar von FLO). Wenn man an etwas schuld ist, kann man Abbitte leisten; indem man zumidest mal einen finanziellen Schaden behebt. Die Schuld, die ja als Ursache für eine negative Wirkung zu verstehen ist, lässt sich nicht weg-entschuldigen. Das Wort „Entschuldigung“ taugt lediglich als Floskel, wenn man jemanden aus Versehen (!) angerempelt hat, z.B.
Richtig schlecht wird mir, wenn Profigläubige wieder mal vom „Herzen“ reden; dann ist immer verquaste zuckersüße Esoterik fällig. Vom gerade befruchteten weiblichen Ei z.B. behauptet die katholische Kirche, dass in dessen HERZ Gott von seiner unendlichen Liebe eingiessen würde. Dass er es gleichzeitig mit der Erb-Schuld belastet, die im übrigen durch keine Entschuldigung getilgt werden kann, findet in diesen Zusammenhängen (Diskussion um Abtreibung) selbstverständlich keine Erwähnung.