Gedanken zum Beitrag: Das Gedenken an die Verstorbenen im November – verkündigt von Stadtpfarrer Stefan Buß, veröffentlicht am 5.11.25 von osthessen-news.de
Darum geht es
Stefan Buß verschleiert durch unbelegte Jenseitsversprechungen religiöser Trauerrituale eine ehrliche Auseinandersetzung mit dem Tod, während gerade die Anerkennung unserer Sterblichkeit den wahren Wert und die Würde des gegenwärtigen Lebens offenbart.Der Fuldaer Stadtpfarrer Stefan Buß lädt in seinem heutigen November-Beitrag dazu ein, das Gedenken an Verstorbene im Licht christlicher Hoffnung zu betrachten. Aus säkular-humanistischer Perspektive offenbart dieser Text jedoch, wie religiöse Narrative existenzielle Ängste mit unbelegten Versprechungen adressieren – und dabei wichtige Aspekte einer reifen Auseinandersetzung mit Sterblichkeit verfehlen.
Das Problem unbegründeter Gewissheiten
Buß schreibt mit bemerkenswerter wie altbekannter Selbstverständlichkeit davon, dass Verstorbene „in Gottes Herrlichkeit leben“ und „geborgen sind in Gott“. Diese Aussagen werden als Tatsachen präsentiert, nicht als das, was sie sind: unbelegte religiöse Überzeugungen. Es gibt keinerlei empirische Evidenz für ein Weiterleben nach dem Tod, für eine göttliche Geborgenheit oder gar für die Existenz der beschworenen Gottheit selbst.
Die Formulierung „Wir glauben daran, dass sie nicht ins Nichts gefallen sind“ verschleiert geschickt, dass Glaube und Wissen fundamental verschiedene Kategorien sind. Der Wunsch, dass etwas wahr sein möge, macht es nicht wahrlich wahr. Diese Verwischung der Grenzen zwischen Hoffnung und Realität mag kurzfristig tröstlich erscheinen, verhindert aber eine ehrliche Auseinandersetzung mit der Endlichkeit.
Christliche Trauerrituale: Die Instrumentalisierung der Trauer
Besonders problematisch ist die Aussage, das Gedenken sei „auch ein Dienst an uns selbst“. Hier wird Trauerarbeit funktionalisiert und in ein religiöses Deutungssystem eingespannt. Die Verbindung zu „Wurzeln unserer Familie, unserer Gemeinde“ wird mit der kirchlichen Tradition verknüpft – als ob authentische Erinnerung und Dankbarkeit eines religiösen Rahmens bedürften.
Tatsächlich können Menschen auch ohne transzendente Versprechen tief und bedeutungsvoll trauern. Die Behauptung, nur der Glaube an ein Wiedersehen „in der Vollendung bei Gott“ könne wirklich trösten, entwertet säkulare Formen der Trauerbewältigung und suggeriert, ein Leben ohne diese Hoffnung sei defizitär.
Natürliche Metaphern, übernatürliche Schlüsse
Buß nutzt geschickt die Metapher der fallenden Blätter und des natürlichen Kreislaufs. Doch dann vollzieht er einen logischen Sprung: Aus der Beobachtung natürlicher Vergänglichkeit folgert er ein „Aufgehobensein in Gottes Hand“. Dies ist ein klassischer Fehlschluss. Die Natur zeigt uns Zyklen von Werden und Vergehen, aber nirgends einen Hinweis auf individuelle Unsterblichkeit oder göttliche Intervention.
Der Herbst lehrt uns tatsächlich etwas über Leben und Tod – aber die Lektion ist eine naturalistische: Alles Lebendige endet, wird zu Nährstoffen für neues Leben, geht in den großen Kreislauf der Materie ein. Das ist die tatsächliche „Auferstehung“ – nicht als persönliches Weiterleben, sondern als Teil des kontinuierlichen Prozesses der Natur.
Die Würde der Endlichkeit
Aus humanistischer Sicht verkennt Buß die tiefe Würde, die gerade in der Anerkennung echter Endlichkeit liegt. Die Aussage, unser Leben sei „nicht sinnlos“, wird an die Ewigkeitsperspektive gebunden – als ob ein endliches Leben nicht aus sich heraus sinnvoll sein könnte. Das Gegenteil ist wahr: Gerade die Begrenztheit verleiht jedem Moment, jeder Begegnung, jedem gelebten Tag seinen besonderen Wert.
Die „Hoffnung auf Auferstehung“ mag psychologisch entlastend wirken, aber sie birgt auch die Gefahr der Abwertung des Hier und Jetzt. Wenn das eigentliche Leben erst nach dem Tod beginnt, wird das gegenwärtige Dasein zur bloßen Durchgangsstation. Eine säkulare Ethik hingegen erkennt an: Dieses Leben ist alles, was wir haben – und das macht es umso kostbarer.
Ehrliche Trauer statt frommer Illusion christlicher Trauerrituale
Der November mit seiner manchmal dunklen, introspektiven Atmosphäre lädt tatsächlich zur Reflexion über Vergänglichkeit ein. Aber wir benötigen dafür keine religiösen Versprechen. Wir können anerkennen:
- Unsere Verstorbenen leben in unseren Erinnerungen, in den Werten, die sie uns vermittelten, in den Auswirkungen ihres Handelns – nicht als bewusste Wesen in einer jenseitigen Sphäre, sondern als prägender Teil unserer Geschichte.
- Die „Lücke“, von der Buß spricht, darf nicht nur da sein – sie ist da, und keine noch so schöne religiöse Erzählung kann sie füllen. Ehrliche Trauerarbeit bedeutet, diesen Verlust anzuerkennen, nicht ihn durch Jenseitsphantasien zu relativieren.
- Die Vergänglichkeit ist nicht Vorstufe zur Ewigkeit, sondern die Bedingung aller Wertschätzung. Wir sollten nicht „das Leben im Licht der Ewigkeit“ betrachten, sondern die Ewigkeit der Gegenwart im Leben selbst suchen.
Fazit: Menschlichkeit braucht keine Metaphysik
Stefan Buß‘ Beitrag ist ein Beispiel für religiöse Deutungshoheit über existenzielle Erfahrungen. Die kirchliche Vereinnahmung von Trauer und Gedenken verschleiert, dass Menschen seit jeher – und zunehmend – auch ohne religiöse Rahmen mit Verlust und Endlichkeit umgehen können.
Eine reife, humanistische Haltung gegenüber dem Tod erfordert Mut zur Wahrhaftigkeit: den Mut, Endlichkeit als Endlichkeit anzuerkennen, Trost in realen menschlichen Beziehungen zu suchen statt in unbeweisbaren Jenseitsversprechen, und Sinn im gelebten Leben selbst zu finden, nicht in einer hypothetischen Fortsetzung nach dem Tod.
Der November kann uns daran erinnern, dass wir sterblich sind – und dass gerade diese Sterblichkeit uns dazu aufruft, das Leben zu würdigen, das wir jetzt haben, und die Menschen zu schätzen, die jetzt bei uns sind. Das ist keine fröhliche Botschaft im konventionellen Sinn. Aber es ist eine ehrliche – und das ist mehr wert als tausend tröstliche Illusionen.









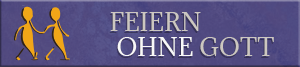
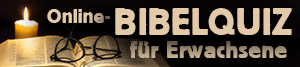
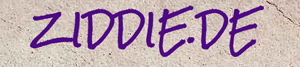


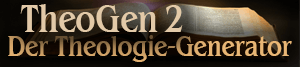

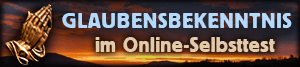
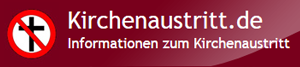
Ich habs hier schon einige male geschrieben, aber nichts entlarvt die Lügen des Christentums besser als ne Beerdigung.
Warum überhaupt trauern?! Eigentlich müssten die alle ne fette Party zelebrieren, mit Spass und Freude, wenns mal wieder einer geschafft hat, ins ach so tolle Himmelreich zu kommen. „Endziel erreicht, Jippieee, er hats geschafft!“
Vielleicht trauern die auch alle, weil sie selbst noch nicht in der Grube liegen und somit ihrem Gott näher sein dürfen.
ODER:
Sie alle wissen haargenau, dass dies alles eitler Selbstbetrug ist und ergötzen sich trotzdem an ihrem verlogenen Massenwahn…