Oder: Warum Stadtpfarrer Buß‘ demokratische Heiligsprechung gefährlicher ist als elitäre Überhöhung
Gedanken zu Beitrag: Ein Heiliger ist auch nur ein Mensch! Gedanken zum Fest Allerheiligen, verkündigt von Stadtpfarrer Stefan Buß aus Fulda, veröffentlicht am 2.11.25 von osthessen-news.de
Darum geht es
Stadtpfarrer Stefan Buß aus Fulda vereinnahmt alltägliche menschliche Tugenden als religiöse Leistungen, macht die Überwindung von Schwächen von Gott abhängig und installiert damit einen totalen religiösen Deutungsanspruch über alle Lebensbereiche, während er verschweigt, dass Heiligsprechung ein politisches und kommerzielles Instrument der Kirche ist, das Hunderttausende bis Millionen Euro kostet und damit faktisch nur zahlungskräftigen Kandidaten offensteht.Stadtpfarrer Stefan Buß aus Fulda hat eine Mission: Er will uns alle zu Heiligen machen. Sein Beitrag zu Allerheiligen ist ein Meisterwerk religiöser Vereinnahmung, das unter dem Deckmantel der Niedrigschwelligkeit eine zutiefst manipulative Botschaft transportiert. Schauen wir genauer hin.
Die große Nivellierung: Wenn alle heilig sind, ist niemand mehr besonders
Buß beginnt mit einer scheinbar sympathischen Entmystifizierung: „Ein Heiliger ist auch nur ein Mensch!“ Wie beruhigend. Wie einladend. Und wie perfide. Denn was hier geschieht, ist keine Humanisierung der Heiligen, sondern eine Sakralisierung des Alltäglichen – mit einem klaren Ziel: Die Eingliederung jedes Lebens in das religiöse Narrativ.
Wenn die Mutter, die „im Alltag treu ihre Familie trägt“, zur potenziellen Heiligen wird, wenn der Vater, der „Verantwortung übernimmt“, heilig sein kann, wenn sogar „die Alten, die geduldig ihr Kreuz tragen“, in diese Kategorie fallen – dann hat die Kirche einen genialen Schachzug vollzogen: Sie hat das normale menschliche Leben zu ihrem Eigentum erklärt.
Die Anmaßung der religiösen Deutungshoheit
Besonders entlarvend ist die Liste dessen, was laut Buß Heiligkeit ausmacht:
- Mütter, die ihre Familie „tragen“
- Väter, die Verantwortung übernehmen
- Alte Menschen, die geduldig leiden
- Junge Menschen, die ihren Glauben bekennen
- Menschen, die im Verborgenen Gutes tun
Fällt etwas auf? Vier von fünf Beispielen sind universell menschliche Verhaltensweisen, die absolut nichts mit Religion zu tun haben. Nur bei den „Jungen, die mutig ihren Glauben bekennen“ wird die religiöse Agenda explizit.
Hier offenbart sich die Kernstrategie: Die Kirche vereinnahmt alltägliche menschliche Tugenden – Verantwortungsbewusstsein, Fürsorglichkeit, Geduld, Hilfsbereitschaft – und etikettiert sie als religiöse Leistung. Menschen, die ohne jeden Gottesglauben liebevoll, verantwortlich und hilfsbereit leben, werden implizit entwertet. Ihre Motive gelten als unvollständig, ihre Ethik als defizitär, denn wahre Heiligkeit bedeutet ja: „mit meinen Fehlern auf Gott zuzugehen.“
Die Umdeutung menschlicher Schwächen
Buß‘ Heiligengalerie ist aufschlussreich:
- Petrus – voller Zweifel, Verleugner
- Paulus – Christenverfolger
- Franziskus – zügellos
- Teresa von Ávila – ungeduldig
- Mutter Teresa – innerlich finster
Die Botschaft: Siehst du, selbst die größten Versager können heilig werden – wenn sie nur auf Gott vertrauen!
Was hier als tröstliche Ermutigung verpackt wird, ist tatsächlich eine toxische Botschaft: Deine Fehler, deine Zweifel, deine innere Dunkelheit – all das ist nur erträglich, ja, nur verwandelbar, wenn du dich Gott unterwirfst. Menschliche Autonomie bei der Bewältigung von Krisen wird delegitimiert. Der Mensch, der aus eigener Kraft an seinen Schwächen arbeitet, seine Zweifel produktiv nutzt, seine innere Finsternis ohne metaphysische Krücken durchschreitet – dieser Mensch kommt in Buß‘ Weltbild nicht vor.
Die Manipulation durch falsche Bescheidenheit
Besonders perfide ist der Satz: „Vielleicht sitzt der nächste ‚Heilige‘ gerade neben dir in der Bank. Vielleicht bist du es selbst – ohne es zu merken.“
Das klingt nach demokratischer Öffnung, ist aber psychologische Manipulation auf mehreren Ebenen:
- Die Schaffung falscher Hoffnung: Jeder kann heilig sein! (Aber nur unter den Bedingungen der Kirche.)
- Die Erzeugung von Unsicherheit: Vielleicht bist du es schon – ohne es zu merken! (Also solltest du besser gläubig bleiben, um es nicht zu verpassen.)
- Die Etablierung sozialer Kontrolle: Der Heilige sitzt neben dir! (Also sei vorsichtig, wie du dich verhältst – religiöse Bewertung ist überall.)
- Die Infantilisierung der Gläubigen: Du merkst es nicht mal! (Du brauchst also die Kirche, die dir sagt, wer du bist.)
Die Seligpreisungen als Unterwerfungsprogramm
Buß zitiert die Bergpredigt, und es ist bezeichnend, wie er sie interpretiert:
„Selig, die arm sind vor Gott“ – übersetzt: „die wissen, dass sie Gott brauchen.“
Nein. Diese Seligpreisung handelt von sozialer Gerechtigkeit, vom Leiden der tatsächlich Armen. Buß macht daraus eine spirituelle Abhängigkeitserklärung. Die Botschaft: Erkenne deine Bedürftigkeit, deine Unvollkommenheit, deine Abhängigkeit von Gott an. Das ist keine frohe Botschaft, das ist die Zementierung erlernter Hilflosigkeit.
„Selig, die Frieden stiften“ – übersetzt: „die Versöhnung wagen.“
Keine Erwähnung davon, dass man dafür keinen Gott braucht. Konfliktvermittlung, Empathie, Kompromissbereitschaft sind menschliche Fähigkeiten, die in säkularen Kontexten oft besser funktionieren als in religiösen, wo „wahre Versöhnung“ immer die Unterwerfung unter göttliche Gebote voraussetzt.
„Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden“ – übersetzt: „die treu bleiben, auch wenn es schwer wird.“
Hier wird Widerstand gegen Ungerechtigkeit subtil umgedeutet in Standhaftigkeit im Glauben. Die ursprünglich politische Dimension der Seligpreisung wird entschärft zur frommen Durchhalteethik.
Was Buß verschweigt: Die wirklich dunklen Seiten der „Heiligen“
Buß erwähnt zum Beispiel, dass Paulus Christen verfolgte, präsentiert dies aber als überwundene Phase, als Beleg für Gottes verwandelnde Kraft. Was er verschweigt:
- Paulus‘ Frauenfeindlichkeit, die bis heute kirchliche Strukturen prägt
- Die problematischen Aspekte von Franziskus‘ Askese, die in Selbstkasteiung und Körperverachtung mündete
- Mutter Teresas fragwürdige medizinische Praktiken, ihr Glorifizieren des Leidens, ihre Nähe zu Diktatoren (mehr dazu hier und hier)
- Die zahllosen „Heiligen“, die an Kreuzzügen, Inquisition und Zwangsmissionierung beteiligt waren
Die Heiligsprechung ist und war immer auch ein politisches Instrument der Kirche, um bestimmte Verhaltensweisen zu belohnen und Machtstrukturen zu festigen. Wer heiliggesprochen wird, entscheidet sich nicht nach objektiven moralischen Kriterien, sondern nach kirchenpolitischer Opportunität.
Die Heiligsprechung als lukratives Geschäftsmodell des Kirchenkonzerns
Was Buß ebenfalls verschweigt: Heiligsprechungen sind ein äußerst profitables Geschäft für die katholische Kirche. Der Prozess der Kanonisierung ist nicht nur langwierig und bürokratisch, sondern vor allem: extrem teuer.
Die Kosten für eine Heiligsprechung können mehrere hunderttausend bis zu mehreren Millionen Euro betragen. Diese Summen müssen in der Regel von den Antragstellern – oft Diözesen, Orden oder Initiativgruppen – aufgebracht werden. Dabei fallen Kosten an für:
- Anwälte und Postulanten (kirchliche Juristen, die den Fall vorbereiten und vor der Kongregation vertreten)
- Medizinische und wissenschaftliche Gutachten zur Überprüfung angeblicher Wunder
- Historische Recherchen und Dokumentationen des Lebens des Kandidaten
- Übersetzungen aller Dokumente ins Italienische
- Verwaltungsgebühren beim Vatikan
- Die Zeremonie selbst – eine Heiligsprechung auf dem Petersplatz kostet zusätzlich Hunderttausende
Konkrete Beispiele:
Die Heiligsprechung von Mutter Teresa im Jahr 2016 kostete schätzungsweise mehrere Millionen Euro. Die Diözese Kalkutta, unterstützt durch internationale Spenden, musste diese Summe aufbringen – während gleichzeitig in den Slums der Stadt Menschen an behandelbaren Krankheiten starben.
Die Seligsprechung von Papst Johannes Paul II. wurde in rekordverdächtiger Geschwindigkeit durchgeführt – auch weil ausreichend finanzielle Mittel vorhanden waren. Der Prozess kostete mehrere Millionen Euro, die unter anderem aus polnischen Diözesen und von Gläubigen weltweit stammten.
Besonders perfide: Ärmere Kandidaten haben faktisch keine Chance auf Heiligsprechung, weil ihre Anhänger die Kosten nicht aufbringen können. Die Heiligen der Kirche sind also nicht die moralisch Vorbildlichsten, sondern jene, für die genug Geld zusammenkam.
Dazu kommt die indirekte kommerzielle Verwertung: Heiligsprechungen ziehen Pilger an, beleben den Devotionalienhandel (Bilder, Statuen, Medaillen, Reliquien), schaffen touristische Attraktionen und generieren Spendeneinnahmen. Wallfahrtsorte zu Heiligen sind für die Kirche Goldgruben. Lourdes, Fatima, Santiago de Compostela – überall fließt Geld in kirchliche Kassen, finanziert durch die Verehrung von Menschen, die als „heilig“ vermarktet werden.
Die Heiligsprechung ist also nicht nur ein politisches, sondern auch ein ökonomisches Instrument der Kirche: Sie bindet finanzielle Ressourcen an sich, schafft profitable Pilgerorte und verkauft religiöse Illusionen als spirituelle Ware. Wenn Buß von Heiligkeit spricht, verschweigt er, dass der Weg dorthin mit Geld gepflastert ist – und dass am Ende nicht Gott entscheidet, sondern die Zahlungsfähigkeit der Gläubigen.
Die eigentliche Botschaft hinter der Fassade
Buß‘ scheinbar niedrigschwelliges Heiligkeitskonzept ist in Wahrheit eine Totalisierung religiöser Ansprüche. Die Botschaft lautet:
- Alles Gute, das du tust, ist eigentlich Gottes Werk in dir.
- Alle Schwächen, die du hast, sind nur durch Gott überwindbar.
- Dein Leben hat nur dann Wert und Richtung, wenn du es von Gott verwandeln lässt.
- Ohne religiöse Einbettung bleibt dein moralisches Leben unvollständig.
Das ist keine Befreiung, sondern religiöser Totalitarismus im Gewand der Niedrigschwelligkeit.
Was wir statt „Heiligkeit“ brauchen: Humanistische Ethik
Die säkulare, humanistische Perspektive braucht keine Heiligen. Sie braucht:
Menschen, die aus eigenem Antrieb und eigener Einsicht ethisch handeln – nicht weil ein Gott es befiehlt oder belohnt, sondern weil sie die Würde und das Leid anderer Menschen erkennen und darauf reagieren wollen.
Die Anerkennung menschlicher Autonomie – Menschen sind fähig, moralisch zu handeln, Fehler zu erkennen, sich zu verändern, ohne metaphysische Krücken.
Realistischen Umgang mit menschlichen Unzulänglichkeiten – wir sind biologische Wesen mit evolutionär geformten Verhaltenstendenzen. Moral entsteht im Spannungsfeld zwischen diesen Tendenzen und unserem Reflexionsvermögen, nicht durch göttliche Intervention.
Würdigung ohne Sakralisierung – wir können Menschen ehren, die Außergewöhnliches geleistet haben, ohne sie zu „heiligen“ oder ihre Taten religiös zu überhöhen.
Kritische Auseinandersetzung mit moralischen Vorbildern – niemand ist über Kritik erhaben. Die Heiligsprechung immunisiert Menschen gegen berechtigte Infragestellung.
Die Gefahr der Demokratisierung der Heiligkeit
Paradoxerweise ist Buß‘ demokratischer Ansatz – „jeder kann heilig sein“ – gefährlicher als die alte elitäre Heiligenverehrung. Warum?
Weil er subtiler ist. Die strahlende, unerreichbare Heiligenfigur konnte man als Gläubiger bewundern, ohne sich persönlich unter Druck gesetzt zu fühlen. Buß‘ Heiligkeit der „Mutter, die im Alltag ihre Familie trägt“ schafft einen permanenten religiösen Bewertungsdruck des Alltäglichen.
Weil er totaler ist. Wenn jede gute Tat potenzielle Heiligkeit ist, dann gibt es keinen ethischen Bereich mehr außerhalb religiöser Deutungshoheit.
Weil er unwidersprechbarer erscheint. Wer will schon gegen die Würdigung „der Mütter“ und „der Alten“ argumentieren? Die manipulative Verknüpfung von universellen menschlichen Tugenden mit religiöser Agenda macht Kritik schwer.
Fazit: Die freundliche Umarmung, die erstickt
Stefan Buß‘ Impuls zu Allerheiligen ist exemplarisch für moderne kirchliche Kommunikationsstrategien: Man gibt sich niedrigschwellig, inklusiv, menschenfreundlich – und installiert dabei umso effizienter die religiöse Deutungshoheit über alle Lebensbereiche.
„Ein Heiliger ist auch nur ein Mensch“ – dieser Satz klingt wie Demut, ist aber das Gegenteil: Er ist die Anmaßung, menschliches Leben nur dann als vollständig anzuerkennen, wenn es von Gott „verwandelt“ wurde.
Die Wahrheit ist: Ein Mensch ist ein Mensch. Nicht mehr, nicht weniger. Manche Menschen leben ethisch vorbildlicher als andere. Manche überwinden große persönliche Schwächen. Manche setzen sich mutig für andere ein. All das verdient Respekt und Anerkennung.
Aber es braucht keine Götter dafür. Es braucht keine Kirche dafür. Es braucht keine Heiligsprechung dafür.
Was es braucht: Menschen, die die Verantwortung für ihr Leben und ihre Ethik selbst übernehmen, statt sie an metaphysische Instanzen zu delegieren.
Allerheiligen ist kein „Fest der Hoffnung“, wie Buß behauptet. Es ist ein Fest der religiösen Vereinnahmung menschlicher Güte. Und dagegen sollten wir uns wehren – nicht aggressiv, aber entschieden.
Denn das wirklich Heilige ist nicht die Unterwerfung unter Gott, sondern die Würde des autonomen, selbstverantwortlichen, mitfühlenden Menschen.









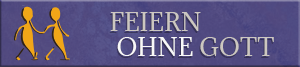
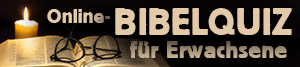
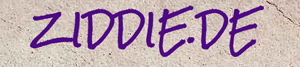


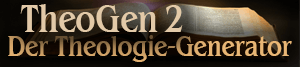

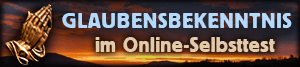
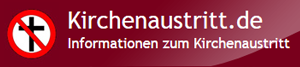
Ein Heiliger ist vor allem eins: TOT!
Aber ist schon interressant, wie die Kirche es perfektioniert hat, selbst tote Kühe noch zu melken…
Dieser ganze Heiligenzirkus, der nichts anderes ist als ein Ersatz für die Vielgötterei des „heidnischen“ Altertums, ist so lächerlich und mittlerweile so inflationär, dass selbst ein verzweifelter Versuch, den Begriff Heiligkeit aus den himmlichen Höhen auf die profane Erde runterzubugsieren und ihn scheinbar zu demokratisieren, wie der von Herrn Buss, völlig ins Leere gehen muss.
Ich zitiere mal aus dem Heiligenkalender auf katholisch.de über den „heiligen“ Stephan von Ungarn, der sogar Nationalheiliger der Ungarn ist:
„Nach dem Tod seines einzigen Sohnes Emmerich fürchtete Stephan um sein Lebenswerk. Um seine zum Heidentum neigenden Cousins regierungsunfähig zu machen, liess er sie blenden und ihnen Blei in die Ohren giessen. Zu seinem Thronfolger ernannte er stattdessen seinen christlichen Neffen Peter Orsoleo. Stephan starb am 15. 8. 1038 und gilt als Nationalheiliger der Ungarn.“
Und katholisch.de ist sich entweder nicht zu blöd oder völlig schmerzfrei, sowas auch noch zu veröffentlichen.
Das ist übrigens nicht die einzige Horroranekdote aus dem Heiligenkalender. Man muss sich nur mal die Mühe machen, darin zu stöbern. Da stehen einem die Haare zu Berge.
Nicht zu vergessen: den aktuellsten Heiligen, den Influenzer Gottes, Carlo Acutis, der sich seine Heiligkeit recht billig mit einer Internet-Liste von sogenannten „Blutwundern“ und recht teuer mit dem Geld seiner Familie verdiente. Und auch die an ihm begangene Leichenfledderei sowie die Zurschaustellung seines aufbereiteten Leichnams sind geradezu widerwärtige Beispiele des Heiligenkults.
Und nicht zu vergessen, dass seine Liste Ereignisse enthält, die aus dem Mittelalter stammen und schon damals zu dem Zweck erfunden wurden, um den Antijudaismus, wenn nicht gar den Antisemitismus zu fördern, z. B. die angebliche Schändung von Hostien, die dann meistens zu Progromen an der jüdischen Bevölkerung führten.
Danke für diesen sehr aufschlussreichen Artikel. Ich glaube mich noch daran erinnern zu können, dass uns damals im schulischen Religionsunterricht die „Heiligen“ als moralisch absolut hochstehend präsentiert wurden, so dass man nur noch zu ihnen aufschauen konnte. Dass sich dahinter einfach nur ein schnöder Kommerz verbirgt, den sich letztendlich nur die Superreichen leisten können, wurde wohlweislich verschwiegen. Eigentlich wurden wir belogen.
Werte Frau Richter,
die Religion, hier insbesondere die christliche, ist von A bis Z eine einzige, monströse Lüge, in der ständig und gewaltsam darüber gestritten wird, wieviel Engel auf eine Nadelspitze passen. 🙂
Danke, Herr Schneck! Es sieht wohl so aus, als ob der gesamte Klerus anscheinend ständig zu viel Lack gesoffen hätte.😜 Diese ganzen Lügenmärchen habe ich zum Glück schon längst hinter mir gelassen. Meinetwegen bin ich vielleicht in den Augen der (kath.) Kirche bereits exkommuniziert, aber das ist mir sowas von schnurz. Liebe Grüße und schönes Wochenende