Gedanken zum Beitrag: Tod als Tor zum Leben: Pontifikalämter im Dom zu Allerheiligen und Allerseelen von (mis/pm), veröffentlicht am 3.11.25 von osthessen-news.de
Darum geht es
Heute untersuchen wir, inwieweit die Allerheiligen-Predigt von Weihbischof Diez im Fuldaer Dom aus rationaler Sicht intellektuell unredlich und potenziell schädlich ist.Grundlegende Problematik der Dichotomie
Der Beitrag konstruiert von Anfang an eine problematische Gegenüberstellung zwischen „Gläubigen“ und „Nichtgläubigen“. Weihbischof Diez behauptet, für Nichtgläubige bedeute der Tod „das Ende des Lebens“ – eine Formulierung, die implizit als defizitär dargestellt wird. Diese Dichotomie ignoriert die philosophische Tiefe säkularer Lebensperspektiven und reduziert Atheismus auf ein vermeintliches „Nichts“.
Die Entwertung des diesseitigen Lebens
Besonders problematisch ist die Bezeichnung des Todes als „Tor zum Leben, zum Licht, zur Ewigkeit“. Diese Metapher wertet das reale, gegenwärtige Leben systematisch ab zugunsten eines unbelegten Jenseits. Aus rationaler Sicht ist dies eine gefährliche Umkehrung: Das einzige Leben, das wir mit Sicherheit haben, wird zur bloßen Vorstufe erklärt.
Die Formulierung vom „Mehrwert eines gläubigen Lebens“ ist besonders aufschlussreich: Sie behandelt Religion wie ein Konsumprodukt und verspricht Vorteile, die empirisch nicht nachweisbar sind – eine Form des geistigen Verkaufsgesprächs, mit unübersehbaren Parallelen zum klassischen Trickbetrug.
Epistemologische Probleme
Der gesamte Text beruht auf unbelegten Behauptungen über ein Leben nach dem Tod, ohne auch nur anzuerkennen, dass es dafür keinerlei wissenschaftliche Evidenz gibt. Formulierungen wie „wir dürfen ihn schauen“ und „die wiedersehen, die uns vorausgegangen sind“ werden als Fakten präsentiert, obwohl es sich um reine Glaubensannahmen handelt.
Aus naturalistischer Perspektive sprechen alle neurowissenschaftlichen Erkenntnisse dafür, dass das Bewusstsein an neuronale Prozesse gebunden ist und mit dem Hirntod endet. Die Behauptung eines fortbestehenden Bewusstseins nach dem Tod widerspricht dem aktuellen Stand der Wissenschaft.
Zur Bergpredigt und den Seligpreisungen
Diez wehrt sich gegen den Vorwurf, mit der Bergpredigt könne man nicht die Welt regieren, und behauptet gleichzeitig, die Seligpreisungen seien „keine Jenseitsvertröstungen“. Hier zeigt sich ein Widerspruch: Einerseits wird das Jenseits als zentrales Versprechen präsentiert, andererseits soll die Bergpredigt gegenwärtig wirken.
Aus humanistischer Sicht sind viele Werte der Bergpredigt (Gewaltfreiheit, Barmherzigkeit, Friedfertigkeit) durchaus unterstützenswert – aber nicht, weil sie göttlich offenbart sind, sondern weil sie empirisch zu menschlichem Wohlergehen beitragen können. Diese Werte benötigen keine religiöse Grundlage und wurden von säkularen Ethikern und Philosophen unabhängig entwickelt.
Die paternalistische Trostformel
Besonders problematisch ist die Passage über jene, die „in der Gesellschaft der Reichen, Schönen und Klugen nicht mehr mitkommen“. Hier wird Religion als Trostpflaster für gesellschaftliche Ungerechtigkeiten präsentiert, statt diese anzuprangern. Dies entspricht der klassischen Marx’schen Kritik: Religion als „Opium des Volkes“, das bestehende Machtverhältnisse stabilisiert, indem es Vertröstung auf ein Jenseits bietet.
Die Bedeutung des Todes aus säkularer Sicht
Aus humanistisch-atheistischer Perspektive gibt der Tod dem Leben gerade dadurch Bedeutung, dass er es begrenzt. Die Endlichkeit macht jeden Moment wertvoll und fordert uns auf, das Hier und Jetzt verantwortungsvoll zu gestalten. Der Tod ist nicht „das Tor zum Leben“, sondern der Abschluss des einzigen Lebens, das wir haben – was diesem eine unermessliche Kostbarkeit verleiht.
Trauer ist aus dieser Perspektive die angemessene Reaktion auf den unwiederbringlichen Verlust eines Menschen. Die Hoffnung auf ein Wiedersehen kann zwar tröstlich wirken, läuft aber Gefahr, die Endgültigkeit des Verlustes zu leugnen und damit auch die Trauerarbeit zu behindern.
Das Geschäftsmodell mit halber Wahrheit
Diez präsentiert den Glauben als reines Gewinnszenario – den „Mehrwert eines gläubigen Lebens“ – und verschweigt dabei systematisch die zentrale Drohkulisse, auf der das christliche Belohnungs- und Bestrafungssystem seit Jahrhunderten aufbaut: die Hölle. Diese Auslassung ist kein Zufall, sondern strategisches Marketing in Zeiten schwindender Kirchenmitgliedschaft.
Die katholische Lehre kennt sehr wohl ein differenziertes Jenseits: Himmel, Fegefeuer und Hölle. Doch während Diez von der „überwältigendes Leben bei Gott in Fülle und Herrlichkeit“ schwärmt, bleibt das ewige Höllenfeuer diskret im Dunkeln. Man stelle sich einen Versicherungsvertreter vor, der nur die Leistungen bewirbt, aber die Bedingungen verschweigt – genau diese Unaufrichtigkeit liegt hier vor.
Die verdrängte Kernfrage
Wenn der Tod wirklich für alle Gläubigen das „Tor zum Leben“ ist – warum dann überhaupt die komplexe katholische Moraltheologie? Wozu Beichte, Buße, Ablasswesen? Die Frage, die Diez seinen Zuhörern vorenthält, lautet: Was passiert mit jenen, die nicht ans Ziel ihrer Sehnsucht kommen? Die katholische Tradition hat darauf eine klare, wenn auch unangenehme Antwort: ewige Verdammnis.
Indem Diez diese Konsequenz verschweigt, entkernt er die eigene Theologie. Entweder ist die Hölle real – dann ist ihre Nichterwähnung eine gefährliche Irreführung der Gläubigen. Oder sie ist es nicht – dann sollte die Kirche ehrlich genug sein, diese mittelalterliche Angstdoktrin offiziell zu verwerfen.
Die Arroganz der Verheißung
Besonders problematisch ist Diez‘ implizite Abwertung der Nichtgläubigen. Für sie bedeute der Tod „das Ende des Lebens“ – formuliert mit kaum verhohlener Herablassung. Dabei unterschlägt er, dass ein Leben ohne Jenseitserwartung keineswegs sinnlos oder trostlos sein muss. Im Gegenteil: Wer weiß, dass dies das einzige Leben ist, hat jeden Grund, es und die Gemeinschaft mit anderen Menschen umso mehr zu schätzen.
Die humanistische Perspektive bietet Trost ohne Täuschung: Die Trauer um Verstorbene wird nicht durch Vertröstungen auf ein imaginäres Wiedersehen relativiert, sondern in ihrer Realität anerkannt. Die Erinnerung an geliebte Menschen, ihr Weiterleben in unserem Handeln und in den Spuren, die sie hinterlassen haben – das sind greifbare, ehrliche Formen des Weiterbestehens, die keiner unbelegbaren metaphysischen Konstruktion bedürfen.
Die intellektuelle Unredlichkeit
Aus rationaler Sicht ist Diez‘ Predigt ein Musterbeispiel selektiver Argumentation: Man nimmt die angenehmen Aspekte einer Glaubenslehre (ewiges Leben, Wiedersehen mit Verstorbenen) und blendet die unangenehmen systematisch aus. Diese Cherry-Picking-Mentalität mag zeitgemäß erscheinen, macht die Argumentation aber nicht kohärenter.
Wer den „Mehrwert“ des Glaubens anpreist, müsste auch ehrlich über das Risiko sprechen – zumindest wenn man die eigene Theologie ernst nimmt. Dass dies nicht geschieht, verrät zweierlei: Entweder glaubt Diez selbst nicht mehr an die Hölle (dann wäre Ehrlichkeit angebracht), oder er hält seine Zuhörer für zu schwach, um die volle Wahrheit zu ertragen (dann wäre das paternalistisch).
Fazit: Trost durch Täuschung?
Eine säkulare, humanistische Ethik verzichtet bewusst auf unbelegbare Jenseitsversprechen – nicht aus Lieblosigkeit, sondern aus intellektueller Redlichkeit. Sie bietet Trost, wo Trost möglich ist, und hält die Realität des Verlustes aus, wo keine ehrlichen Gewissheiten zu haben sind.
Diez‘ Predigt hingegen ist Glaubenswerbung mit verschleiertem Kleingedruckten. Eine Theologie, die ihre eigenen Konsequenzen nicht mehr auszusprechen wagt, hat ihre Überzeugungskraft bereits verloren – auch wenn sie das noch nicht öffentlich zugeben mag.
Der Beitrag präsentiert religiöse Überzeugungen als Fakten und wertet säkulare Lebensperspektiven systematisch ab. Er bietet Trost durch unbeweisbare Versprechungen und fördert eine Haltung, die das reale Leben als sekundär betrachtet.
Aus rationaler Sicht ist dies intellektuell unredlich und potenziell schädlich, da es Menschen davon abhält, ihr einziges gesichertes Leben in vollem Bewusstsein seiner Bedeutung zu leben. Cui bono?
Buchtipp
Esther Vilar
Die Schrecken des Paradieses
Wie lebenswert wäre das ewige Leben?
Die Unausweichlichkeit des Todes hat die Menschen seit je umgetrieben und nach Antworten suchen lassen auf die Frage, was denn nach dem Leben komme. Selbst im „aufgeklärten“ abendländischen Kulturkreis flüchtet sich ein beachtlicher Teil der Bevölkerung in Vorstellungen von Jenseits, Paradies und ewigem Leben. Um die Eintrittskarte dorthin sicher lösen zu können (ob durch die Vergebung ihrer Sünden oder die Verbesserung ihres Karmas), investieren sie einiges ihrer knappen Lebenszeit.
Eine Verschwendung, meint Esther Vilar. Denn wie wäre es eigentlich, wenn es das Paradies im Jenseits wirklich gäbe? Welches Bild von den himmlischen Welten dürfen wir uns machen? Fragt Esther Vilar und führt uns durch den Himmel, erläutert das Sexualverhalten der Engel, verrät Rezepte aus der paradiesischen Küche, analysiert die jenseitige Medienlandschaft… Aber selbst wenn „dort oben“ die beste aller denkbaren Welten existierte – macht es Spaß auf einer Party, die niemals endet, zu tanzen? Oder liegt das Geheimnis der Freude in ihrer zeitlichen Begrenzung?
Für Esther Vilar ist der Fall klar: Die Versicherung der Religionen gegen die Angst vor dem Abschied verstellt uns letztlich den Blick für die Herrlichkeiten des Hierseins. Und es lohnt nicht, das Abkommen „Gehorsam auf Erden gegen Weiterleben im Himmel“ zu unterschreiben. (Quelle: alibri.de)
Erhältlich beim Alibri-Verlag



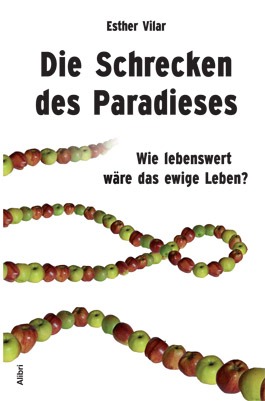






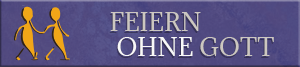
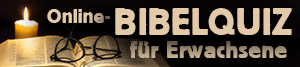
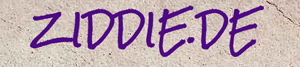


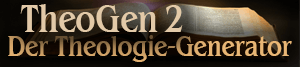

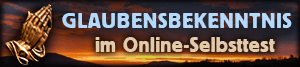
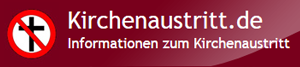
Puh, da haben wir als Atheisten ja noch mal Glück gehabt, dass es für und kein ewiges Leben gibt!
Oder möchte jemand von euch tatsächlich die Ewigkeit mit nem Haufen scheinheiliger, verblendeter Dummschwätzer verbringen, mit denen man es im jetzigen Leben schon keine Stunde im selben Raum aushält?!