Wer hofft, handelt! – Das Wort zum Wort zum Sonntag, verkündigt von Pfarrer Wolfgang Beck, veröffentlicht am 21.06.2025 von ARD/daserste.de
Darum geht es
Diesmal scheitert Pfarrer Beck beim Versuch, Gottvertrauen als brauchbare Hoffnungsquelle fürs Diesseits zu verkaufen.Nachdem es für die katholische Kirche aus bekannten Gründen zusehends schwieriger wird, sich am Markt der Moralanbieter zu behaupten oder hier wenigstens noch in Betracht zu kommen, scheint man inzwischen das Geschäftsmodell zeitgemäß angepasst zu haben.
In Zeiten, in denen sich niemand, der halbwegs klar im Kopf ist noch von Höllendrohungen einschüchtern lässt und in denen jenseitige Heilsversprechen nur noch als bis zur völligen Unkenntlichkeit[1]Ohne die Androhung einer Bestrafung ergibt das Versprechen einer Erlösung davon keinen Sinn. abstrahierte göttliche „Belohnung“ angepriesen werden, braucht man einen anderen Produktnamen. Etwas, das ebenfalls nichts kostet – und mit dem die Zielgruppe etwas anfangen kann.
An der Zielgruppe hat sich kaum etwas geändert: Es sind – früher wie heute – bevorzugt verzweifelte, enttäuschte, verängstigte, mutlose Menschen. Je verzweifelter, desto empfänglicher für Heilsversprechen aller Art. Je mutloser, desto weniger kritisch gegenüber noch so absurden Heils- und Hoffnungsversprechen.
Es ist zum Verzweifeln!
Nach alt bekanntem WzS-Schema erzeugt Herr Beck erstmal ein geeignetes emotionales Szenario:
Es ist zum Verzweifeln! Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, derzeit drängt sich das starke Gefühl auf: Es ist zum Verzweifeln! Es geht nicht gut aus. Es wird immer schlimmer. Noch ein Krieg. Noch ein Despot. Oder im Privaten: noch eine schlimme Diagnose. Noch eine Rechnung. Die Reihe an Desastern ist lang.
Das ist das Substrat, in dem die Angebote von Heilsversprechern besonders gut gedeihen.
Im nächsten Schritt gilt es nun, eine typisch menschliche Reaktion zu skizzieren, die allgemein als nicht zielführend oder hilfreich angesehen wird:
Zynismus, Wut und Aggression
Klar, man könnte zynisch werden, angesichts der schlimmen, ausweglosen Situationen. Eine mögliche Reaktion darauf: Nur noch ein paar schnippische Kommentare. Oder man könnte wütend werden. Und aggressiv. Die Faust in der Tasche ballen und dann mit Wut explodieren – obwohl das auch nichts ändert. Ich erlebe, dass viele Menschen zynisch werden, von der Wut zerfressen. Manche sagen dann: Ich kann mich nicht um die Not der andern kümmern. Das Leben oder die da oben gehen mit mir auch ungerecht um. Fertig. Gibt es Alternativen?
Nachdem die Problemlage beschrieben und emotional aufgeladen ist und Zynismus und Fatalismus als typisch menschliche, aber ungeeignete Reaktionen eingeordnet sind, bringt Pfarrer Beck jetzt die Hoffnung ins Spiel.
Erstmal ganz allgemein:
Hoffnungs-Floskel
Ich wünsche sie mir. Ich beobachte jedenfalls, dass derzeit Bücher auf Bestseller-Listen landen, die sich mit einem überraschenden Thema beschäftigen: der Hoffnung. Seltsam, fast skurril – irgendwie aber auch schön und ermutigend! In dem Desaster, das das persönliche Leben und das gemeinsame gesellschaftliche Leben doch häufig bedeutet, kommt mir schon das Wort „Hoffnung“ nicht so leicht über die Lippen. Es kann abgegriffen wirken. Wie eine Floskel eben.
Klar: Eine diffuse Hoffnung, ohne irgendwelchen konkreten Anhaltspunkte, worin diese Hoffnung denn bestehen soll, ist nichts weiter als eine Floskel.
Worauf also sinnvollerweise hoffen? Natürlich – auf die
„Theologie der Hoffnung“
Das muss aber nicht so sein. Immer wieder suchen Menschen danach, wie sich hoffen und die Realität in der Gesellschaft verändern lässt: in der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre in den USA, in der „Theologie der Hoffnung“ des Theologen Jürgen Moltmann oder in der Vorstellung einer tätigen Hoffnung des marxistischen Philosophen Ernst Bloch. All diese Menschen und ihre Überlegungen haben einen verbindenden Punkt darin, dass Hoffnung für sie nicht nur vertröstet. Hoffnung bezieht sich auch im christlichen Verständnis nicht nur aufs Jenseits. Es ist keine Sache für den „Sankt-Nimmerleins-Tag“. Christliche Hoffnung bezieht sich auch darauf, dass sich hier und jetzt an den unerträglichen Verhältnissen etwas ändert. Und das bedeutet: Wer hofft, handelt!
Vorab: Das gesamte Geschäftsmodell von (monotheistischen) Religionen im Allgemeinen und vom Christentum im Besonderen beruht darauf, die versprochene Hoffnung niemals tatsächlich einlösen zu müssen. Natürlich werden die Gläubigen aufs fiktive Jenseits vertröstet.
Ist das noch Ignoranz – oder schon Betrug?
Diesbezüglich lassen die anonymen Autoren ihren Romanheld Jesus zweifelsfrei klarstellen:
https://www.bibleserver.com/MENG/Matth%C3%A4us6%2C25-34
- »Deswegen sage ich euch: Macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben wertvoller als die Nahrung und der Leib wertvoller als die Kleidung?
- Sehet die Vögel des Himmels an: sie säen nicht und ernten nicht und sammeln nichts in Scheuern, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr wert als sie?
- Wer von euch vermöchte aber mit all seinem Sorgen der Länge seiner Lebenszeit auch nur eine einzige Spanne zuzusetzen?
- Und was macht ihr euch Sorge um die Kleidung? Betrachtet die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen! Sie arbeiten nicht und spinnen nicht;
- und doch sage ich euch: Auch Salomo in aller seiner Pracht ist nicht so herrlich gekleidet gewesen wie eine von ihnen.
- Wenn nun Gott schon das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet: wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen?
- Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: ›Was sollen wir essen, was trinken, womit sollen wir uns kleiden?‹
- Denn auf alles derartige sind die Heiden bedacht. Euer himmlischer Vater weiß ja, daß ihr dies alles bedürft.
- Nein, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch all das andere obendrein gegeben werden.
- Macht euch also keine Sorgen um den morgenden Tag! Denn der morgende Tag wird seine eigenen Sorgen haben; jeder Tag hat an seiner eigenen Mühsal genug.«
So, Herr Beck. Und jetzt erklären Sie mir mal, wie Sie von diesen Aussagen aus Ihrer „Heiligen Schrift“ auf das schmale Brett kommen zu behaupten, die biblische Hoffnung sei keine Vertröstung aufs Jenseits? Und sogar noch mehr als das, nämlich eine Anweisung, sich ausdrücklich nicht um das Diesseits zu sorgen? So, wie die Heiden das mangels Gottvertrauen tun?
Wie praktisch, dass sich eine Textgrundlage mit fiktionalem Charakter beliebig zurechtbiegen lässt, ohne dass sich – mangels Fakten – faktisch irgendetwas ändert.
Während etwa der eine christliche Theologe behauptete, dass auch Atombomben in den Dienst der Nächstenliebe treten können, erfindet ein anderer eben einfach mal eine „Theologie der Hoffnung.“
Gott ists egal.
Der will immer alles, was seine Anhänger behaupten, dass er es will. Deus Io vult. Egal, was es ist. Und egal, welche Konsequenzen es hat.
Und damit zurück zur Sendung:
Die bekannten Kritikpunkte an Moltmanns „Theologie der Hoffnung“ fasst die KI wie folgt zusammen:
perplexity.ai: Kritik an Moltmanns Theologie der Hoffnung
Zentrale Kritikpunkte
1. Unscharfe Zukunftsperspektive
Ein häufig vorgebrachter Kritikpunkt ist, dass Moltmanns Konzept der Hoffnung zwar auf die Zukunft und das „kommende Reich Gottes“ ausgerichtet ist, aber keine konkrete Vorstellung davon entwickelt, wie dieses Reich aussehen soll oder wie es zu erreichen ist. Moltmann selbst reagierte auf diesen Vorwurf mit dem Satz: „Was nicht ist, kann ja noch werden“. Kritiker bemängeln, dass die Theologie der Hoffnung dadurch zu offen und wenig handlungsleitend bleibt.
2. Nähe zu marxistischen Ideen
Moltmanns Hoffnungstheologie ist stark von Ernst Blochs „Prinzip Hoffnung“ beeinflusst, das wiederum marxistische Ideen aufgreift. Dies führte zu Kritik, insbesondere aus konservativen und kirchlichen Kreisen, dass Moltmanns Theologie zu sehr mit linken Utopien und politischem Aktivismus verbunden sei. Moltmann selbst grenzt sich jedoch von einer reinen Fortschrittsgläubigkeit ab und betont, dass die christliche Hoffnung die „Vermessenheiten“ der Utopien zerstört, weil sie sich nicht mit dem Dasein versöhnen lässt56. Dennoch bleibt die Nähe zu marxistischen Denkweisen ein wiederkehrendes Thema in der Kritik.
3. Politisierung und Realitätsferne
Moltmann fordert Christen auf, sich politisch zu engagieren und gegen ungerechte Strukturen zu protestieren. Kritiker hinterfragen, ob eine solche Politisierung der Theologie nicht zu einer Überforderung der Kirchen und Gläubigen führt und ob sie angesichts der Komplexität gesellschaftlicher Realitäten überhaupt praktikabel ist. In der DDR wurde etwa kritisiert, dass das bloße „Nein-Sagen“ zur gesellschaftlichen Wirklichkeit nicht ausreicht und eine Balance zwischen Protest und konstruktivem Engagement nötig sei.
4. Theologische Schwächen
Einige Theologen kritisieren, dass Moltmanns Hoffnungstheologie zu sehr auf die Zukunft und zu wenig auf die Gegenwart und die konkrete Lebenswirklichkeit der Menschen ausgerichtet ist. Sie bemängeln, dass die Theologie der Hoffnung zwar motivierend wirkt, aber wenig konkrete Antworten auf aktuelle ethische und theologische Fragen bietet. Auch wird die Kreuzestheologie Moltmanns teilweise als zu einseitig kritisiert.
Eine weitere Vertiefung erübrigt sich: Sobald Götter und deren angebliche Ansichten, Forderungen und Handlungen ins Spiel gebracht werden, ist der Beliebigkeit Tür und Tor geöffnet.
Und wer tatsächlich irgendwelche Zweifel an dem ungeheuren Gefahrenpotential hat, das von Menschen ausgeht, die sich von ihren jeweils geglaubten Göttern zu Verbrechen aller Art aufgerufen und legitimiert fühlen und solches behaupten, um ihre ebenfalls gläubige Wählerschaft zu beeindrucken, möge sich nur ein Mal die Nachrichten zum aktuellen Weltgeschehen zu Gemüte führen.
Wie USA, Israel und Iran mit Gott argumentieren
Was die Rhetorik der Konfliktparteien angeht, ist es wohl keine Übertreibung, auch von einem Religionskrieg zu sprechen.
Trump (USA): »Ich möchte allen danken. Besonders Gott. Ich will sagen: Wir lieben dich, Gott. Und wir lieben unsere großartigen
Streitkräfte. Schütze sie. Gott segne den Nahen Osten. Gott segne Israel. Und Gott segne Amerika.« (21.6.)Netanyahu (Israel): »Gott segne Amerika. Gott segne Israel. Und möge Gott unser unerschütterliches Bündnis, unseren unerschütterlichen Glauben segnen.« (22.6.)
Khamenei (Iran): »Der Allmächtige Gott wird der iranischen Nation, der Wahrheit und der Seite, die im Recht ist, ganz sicher den Sieg schenken – so Gott will.« (18.6.)
Es ist mir unbegreiflich, mit welcher Selbstverständlichkeit Glaubensverkäufer den massiv negativen Einfluss von Götterglaube selbst dann komplett ausblenden, wenn er so offensichtlich ist wie in der gegenwärtigen Zeit. Und stattdessen auch noch suggerieren, Gottvertrauen sei eine sinnvolle Hoffnungsquelle.
Hoffen und Handeln
„Hoffen und Handeln“ sagt noch lange nichts darüber aus, wie die daraus resultierenden Handlungen aus ethischer, rechtlicher oder völkerrechtlicher Sicht zu bewerten sind. Auch und erst recht nicht, wenn der Bibelgott als Hoffnungsträger herangezogen wird.
Großzügig gesteht Pfarrer Beck ein, dass es eventuell nicht ganz auszuschließen sein könnte, dass vielleicht sogar auch Un- und Andersgläubige irgendwelche Hoffnungsquellen entdecken könnten, die unter Umständen auch geeignet sein könnten, nicht sofort am Weltgeschehen zu verzweifeln.
Bei ihm klingt das natürlich ein wenig anders:
Klar, man muss kein Christ, keine Christin sein, um hoffen zu können, dass die Dinge dieser Welt besser werden. Wer andere Quellen findet, um hoffen und deshalb handeln zu können, pflege sie und nutze sie. Christliche Hoffnung baut auf einem Gottvertrauen auf, das sagt: Es wird gut. Auch da, wo du, Mensch, es noch nicht sehen kannst.
Man beachte den schmierigen theologisch-rhetorischen Trick: Nicht etwa Gott sagt, dass es gut wird. Stattdessen personalisiert Beck das Gottvertrauen, um dieses zum Publikum sprechen zu lassen.
Damit ist der untätige Gott, der sich, sollte er existieren, exakt so verhält, als gäbe es ihn nicht, fein raus. Denn Vertrauen ist ja eine Aktion, die vom Mensch ausgeht. Nicht von Gott.

Wir können und sollten deshalb redlicherweise und im Interesse einer klar verständlichen Sprache „Gottvertrauen“ durch „Einbildung“ ersetzen: Christliche Hoffnung baut auf einer Einbildung auf, die sagt: Es wird gut. Auch da, wo du, Mensch, es noch nicht sehen kannst.“ Und am besten gleich noch als Zusatz: „Frag nicht und glaub’s einfach.“
Im Wischiwaschi-Christentum muss vermutlich gar nicht mehr zwischen „festem Gottvertrauen“ und „purer Einbildung“ unterschieden werden. Hauptsache, es fühlt sich irgendwie kuschelig und bedeutsam an.
Als Theologe weiß Herr Beck natürlich, dass das von ihm vertriebene Glaubenskonstrukt den Anspruch erhebt, nicht nur irgendein optionales Angebot unter vielen zu sein. Wir haben es hier mit den angeblichen Ansprüchen eines dauerbeleidigten und selbstgerechten Monogottes zu tun, den seine Erfinder sich selbst als „eifersüchtig“ und „zornig“ beschreiben lassen. Ganz schön armselig für einen Allmächtigen – aber er kann halt nicht aus seiner Haut…
Mit Gottvertrauen wird es gut!?
Was dabei herauskommt, wenn religiös und damit eben auch christlich motivierte „Weltverbesserer“ behaupten, mit ihrem Gottvertrauen würde „es“ „gut“ („auch da, wo du, gläubiges Schaf, es, anders als ich mit meinem direkten Draht zum lieben Gott, noch nicht sehen kannst“), sehen wir, wie gerade schon geschrieben und mit Zitaten belegt, täglich in den Nachrichten.
Interessant wäre es gewesen zu erfahren, worin denn ein christliches Gottvertrauen konkret bestehen soll?
In der Schnapsidee, dass sich die Götterfiktion aus der biblisch-christlichen Mythologie im Interesse seiner Anhänger in irgendeiner Weise ins irdische Geschehen einmischen würde? Und dafür sorgt, dass sich die bevorzugte Trockennasenaffenart wieder an ihre Regeln hält?
Wie etwa an die, die sich der größte Teil der Weltbevölkerung vor einigen Jahrzehnten in Form der Allgemeinen Menschenrechte mal selbst ausgedacht und gegeben hatten? Rechte, die, nebenbei bemerkt, ausgerechnet von der katholischen Kirche bis heute nicht ratifiziert wurden, weil diese nicht mal die Grundvoraussetzungen dafür erfüllen kann?
Dein Reich komme…
Wovon Gottvertrauen als Basis für ein friedlicheres, faireres, gesünderes Diesseits aus theologischer Sicht abgeleitet werden soll, verrät Pfarrer Beck aus nachvollziehbaren Gründen nicht. Stattdessen belässt er es lieber bei einer Ad hoc-Behauptung, dass die christliche Hoffnung eben auch fürs Diesseits gelten würde.
Dass für diesen irdischen Idealzustand (aus christlicher Sicht) zunächst das so genannte „Reich Gottes“ (natürlich zufällig genau das des Gottes, mit dessen Vertrieb Herr Beck sein Geld verdient) errichtet werden müsste, wozu dann erstmal die Freiheit von Glaube und der Glaube an andere Gottheiten von der Welt getilgt werden müssten, verschweigt er mit der altbekannten theologischen Chuzpe.
Vor der Verlegenheit, diesbezügliche (oder überhaupt irgendwelche kritischen) Nachfragen beantworten zu müssen, ist er in seiner unmoderierten Alleinunterhalter-Reklameshow ja sicher.
Bullshit.
Für die christliche Rede von der Hoffnung scheint mir aber ganz entscheidend zu sein, dass sie nicht an den Desastern, an der Not und Verzweiflung in dieser Welt vorbei bestehen kann.
Doch, Herr Beck! Genau dazu fordert, wie oben zitiert, Ihr Gottessohn auf.
Sinngemäß: Scheiß auf alles, folge mir und freu‘ dich aufs Jenseits!
Und sie verbindet sich mit dem Handeln hier und jetzt und in dieser Welt – mit den israelischen Familien, die um ihre Angehörigen in der Gewalt der Hamas bangen. Mit den hungernden und verzweifelten Menschen in Gaza, in den Kriegsgebieten im Nahen Osten und in der Ukraine. Mit den Menschen, die sehr krank sind oder bei denen auch hier in Deutschland das Geld nicht zum Leben reicht.
Nein, diese Hoffnung verbindet sich eben nicht mit dem Handeln hier und jetzt in dieser Welt!
Sie sind es, Herr Beck, der hier – augenscheinlich verzweifelt und von außen betrachtet erfolglos – versucht, die Absurdität und Irrationalität der biblischen Jenseits-Mythologie mit semantischen Winkelzügen als eine doch noch irgendwie brauchbare Hoffnungsquelle zu retten.
Hoffnung Mensch!
Menschen mit wirklicher Hoffnung nehmen diese Not wahr und ernst. Die französische Philosophin Corine Pelluchon geht noch einen Schritt weiter. Sie sagt, man müsse Verzweiflung erlebt haben, um von Hoffnung sprechen zu können.
Wer die Not von Menschen wahr nimmt, kann nicht auf Unterstützung eines imaginären Phantasiewesens hoffen, wenn er diese Not ernst nehmen möchte. Denn Gottvertrauen als Hoffnung unterscheidet sich nicht von einer rein menschlichen Einbildung oder Wunschvorstellung.
Bloßer Optimismus kann bedeuten, die Augen zu verschließen und das Schmerzhafte zu ignorieren.
Das wiederum beschreibt meines Erachtens exakt das, was Gottvertrauen bedeutet. Sinngemäß: Ich glaube an den richtigen Gott, mir kann nichts passieren.
Wobei ich das nicht als Optimismus, sondern als Realitätsverweigerung, Einbildung oder (Selbst-)betrug bezeichnen würde.
Eine Floskel, mit der Christen die offensichtliche Untätigkeit ihres Gottes auch angesichts noch so schlimmsten Leides gerne versuchen zu entschuldigen und das Leid zu relativieren lautet: „Gott leidet still mit.“ Inwiefern das hoffnungsvoll stimmen kann, verstehen vermutlich nur Christen.
Hoffnung ist dagegen etwas anderes. Sie ignoriert nicht. Wer hofft, sei es ganz klein und zaghaft, der nimmt Anteil und handelt – nicht in Wut, sondern zum Besseren.
Und genau das ist es, was die Hoffnung Mensch ausmacht.
Denn der angeblich still mitleidende Bibelgott hat noch niemals nachweisbar außerhalb von menschlicher Einbildung und Wunschvorstellung gehandelt.
Fazit: Intellektueller Offenbarungseid
Wenn ich Pfarrer Beck richtig verstanden habe, ist der Kern seiner heutigen Aussage sinngemäß dieser: Christen machen die Welt besser, weil sie Gottvertrauen haben, das ihnen sagt, dass es besser wird, auch wenn sie es noch nicht sehen können.
Darauf einen Dujardin® – der Weinbrand für Fortgeschrittene!
Fußnoten
| ↑1 | Ohne die Androhung einer Bestrafung ergibt das Versprechen einer Erlösung davon keinen Sinn. |
|---|









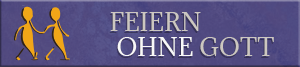
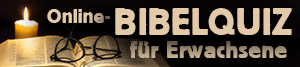
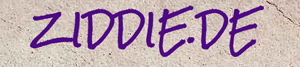


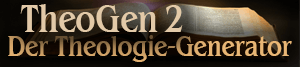

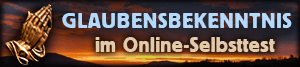
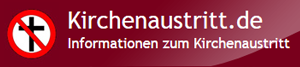
Wenn wir alle einfach den Begriff „Hoffnung“ durch „ÜBERLEBENSINSTINKT“ ersetzen würden, wäre der Kern der Sache erfasst.
Es gibt nur dieses „1!eine1!“ Leben, das dadurch erst recht an Wert gewinnt.
Ein vernünftiges Zusammenleben funktioniert nur, wenn wir uns auf Augenhöhe begegnen, ohne Vorurteile, und uns gegenseitig unterstützen!
Aber irgendwie ist es echt witzig:
Wenn ich dir heute sage, gib mir all dein Geld und du kriegst es zehnfach zurück nachdem du tot bist…
Welcher „Christ“ würde sich darauf einlassen?! KEINER!
Die würden mir alle den Vogel zeigen!
Aber:
Zahle dein Leben lang Kirchensteuer und diverse Spenden, da sind dann alle dabei!
Denn nach dem Tod gibts dafür ja auch ein ewiges Leben…
Daran hat gefälligst jeder zu glauben!
WHAT A DEAL!!! 🙁
Herr Beck,
nun ist es aber genug der Häresie!
Erst zweifeln Sie in Ihrem letzten WzS an der Existenz Ihres imaginären Freundes, wenn Sie in Zwiesprache mit ihm treten.
Und jetzt definieren Sie Hoffnung ganz irdisch im Widerspruch zu Ihrem dreifachen Gott, der alle seine biblischen Redekünste darauf verwendet hat, Ihnen und Ihren Glaubensgenossen das himmlische Jenseits schmackhaft zu machen und das Diesseits als blosses Durchgangslager zu verkaufen (siehe die Zitate in Marcs Kommentar).
Sie nähern sich da ja schon gefährlich dem Gedankengut eines grossen Ketzers an, der schrieb:
„…
Ein neues Lied, ein bessres Lied,
O Freunde, will ich Euch dichten.
Wir wollen hier auf Erden schon
das Himmelreich errichten.
…“
aus „Deutschland, ein Wintermärchen“ Caput I von Heinrich Heine
Wenn das so mit Ihnen weitergeht, Herr Beck, müssen Sie sich bald nach einem neuen Job umsehen. 😉
Tadeln muss ich allerdings Ihre kecke Vereinnahmung von Ernst Bloch für Ihre Geschäftsidee:
„Ernst Bloch war kein religiöser Denker im klassischen Sinne, aber auch kein dogmatischer Atheist. Vielmehr interpretierte er die Religion – insbesonder das Christentum – als eine historisch gewachsene, utopisch aufgeladene Ausdrucksform menschlicher Hoffnung und Emanzipation. Kirche als Institution kritisierte er scharf, insbesondere, wenn sie sich mit Machtstrukturen arrangierte.
Sein Denken kann daher als revolutionär-utopischer Humanismus beschrieben werden, der religiöse Traditionen nicht verwirft, sondern säkular „rettet“ und in ein emanzipatorisches Projekt integriert.“
ChatGPT